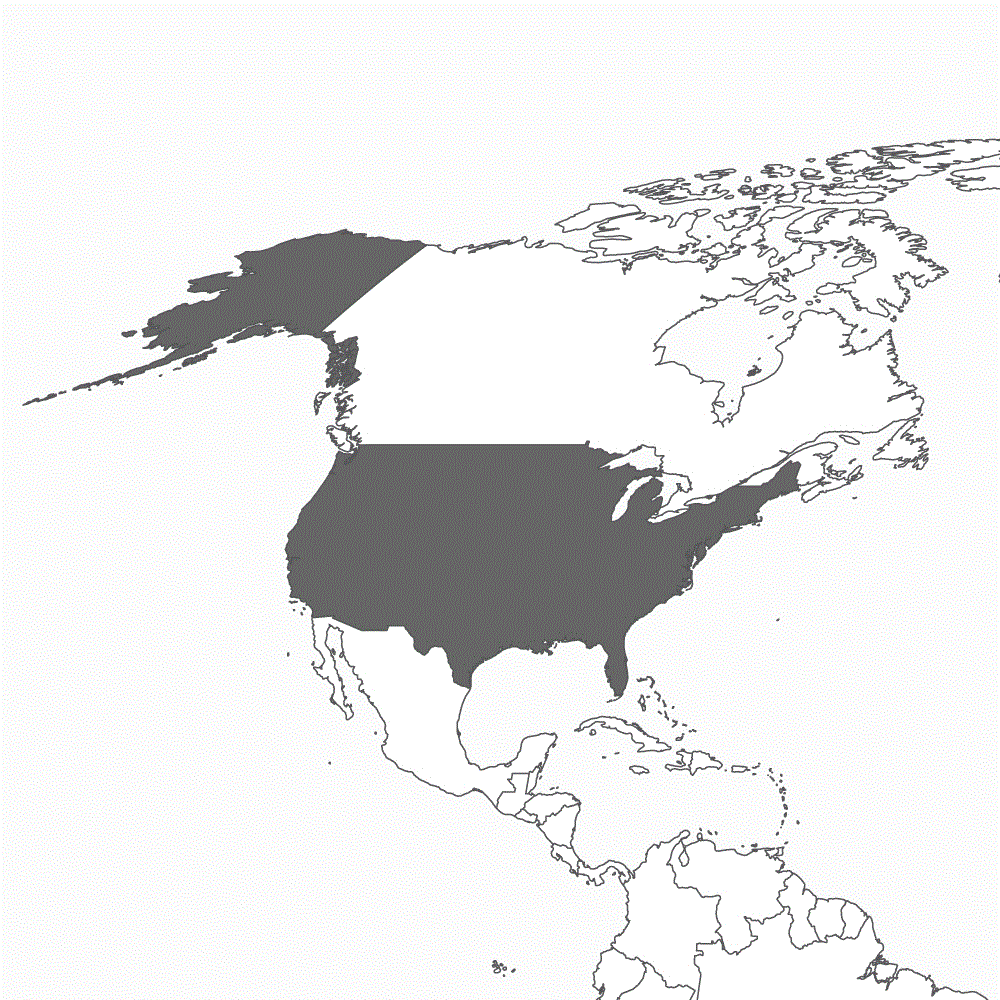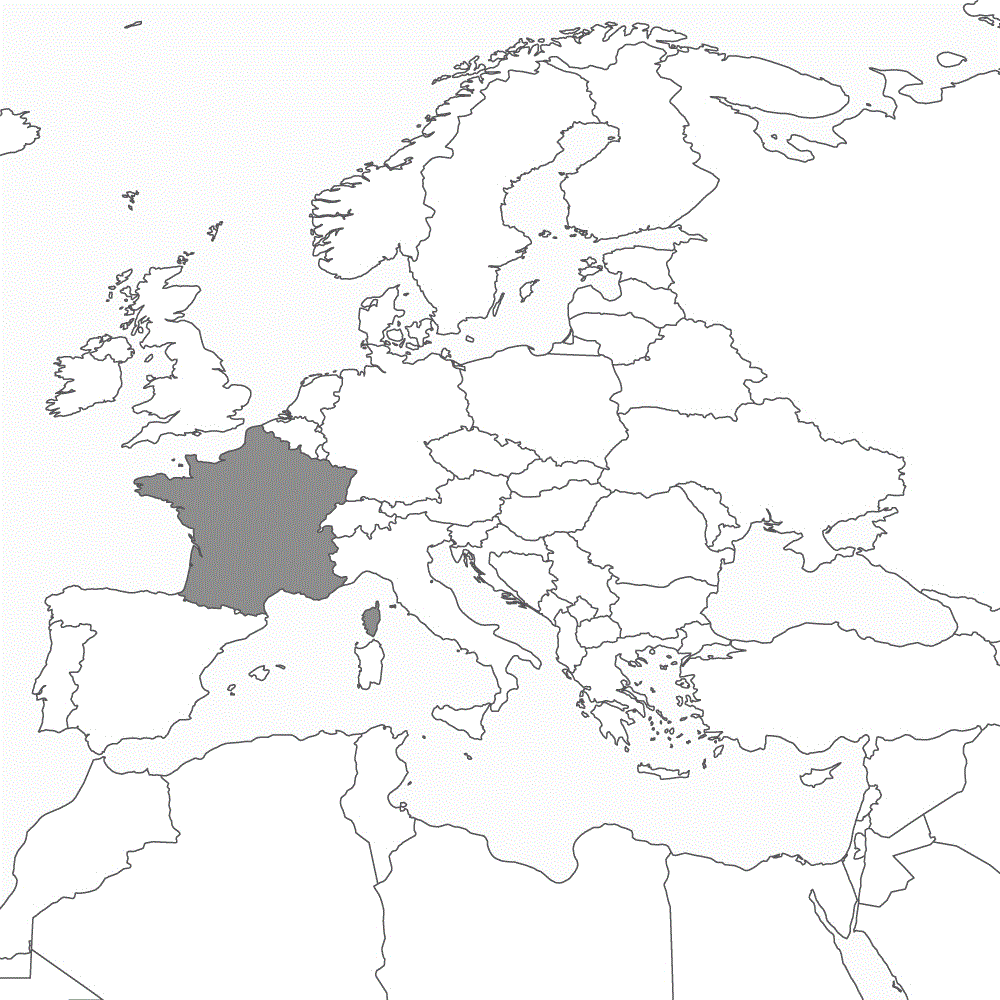Rüstungstreiber Europa
Europa verdoppelt Rüstungsimporte und ist globaler Treiber bei der Militarisierung. Im Rüstungsexport dominieren die USA – auch den europäischen Markt, zum Nutzen deutscher Konzerne und zu Lasten Frankreichs.
BERLIN/PARIS/WASHINGTON (Eigener Bericht) – Die Staaten Europas haben ihre Rüstungsimporte im vergangenen Fünfjahreszeitraum nahezu verdoppelt und treiben damit die Militarisierung weltweit an vorderster Stelle voran. Dies geht aus aktuellen Statistiken des Stockholmer Forschungsinstituts SIPRI hervor. Demnach sind in allen Großregionen weltweit von Afrika über den Mittleren Osten bis Südostasien die Waffeneinfuhren zuletzt teils deutlich zurückgegangen – nur in Europa schnellten sie um 94 Prozent in die Höhe. SIPRI misst in Fünfjahreszeiträumen, um Schwankungen auszugleichen, die in der Rüstungsbranche beim Kauf besonders teurer Waffen – Kampfjets, Kriegsschiffe – regelmäßig entstehen. Größter Rüstungsexporteur sind die Vereinigten Staaten, die ihren Anteil am Weltmarkt auf 42 Prozent ausbauen konnten; die Bundesrepublik liegt auf der Weltrangliste derzeit auf Platz fünf. Während die USA mehr als die Hälfte der europäischen Rüstungseinfuhren abdecken und nun auch europäische Konzerne – etwa Rheinmetall – in ihre Fertigungsketten einbinden, hält Frankreich in Europa einen Marktanteil von nicht einmal fünf Prozent und ist auf Ausfuhren in den Mittleren Osten und nach Asien angewiesen. ex.klusiv
Schlechte Signale
Ernste Differenzen zwischen Berlin und Paris überschatten deutsch-französische Kabinettsklausur in Hamburg. Streitpunkte: Rüstung, Strommarkt, Außenpolitik. Berlin streicht Goethe-Institute in Frankreich.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Ernste Differenzen überschatten die am heutigen Montag beginnende erste gemeinsame Kabinettsklausur der Regierungen Deutschlands und Frankreichs. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens, an dem die Regierungschefs und Minister beider Länder teilnehmen, stehen offiziell der industrielle Wandel und die Stärkung der technologischen Souveränität der EU. Faktisch geht es darum, Möglichkeiten auszuloten, die Beziehungen zwischen Berlin und Paris zu verbessern, die aktuell in desolatem Zustand sind und sich weiter verschlechtern. Schlagzeilen machen regelmäßig mehrere deutsch-französische Rüstungsprojekte, die strategische Bedeutung für die „strategische Autonomie“ der EU hätten, aber kaum von der Stelle kommen oder gar scheitern. Stets kommen neue Streitpunkte hinzu, zuletzt heftige Auseinandersetzungen um die Strommarktreform der EU, aber auch ernste außenpolitische Differenzen, aktuell etwa in der Frage, wie man sich im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan positionieren müsse. Bereits im September konstatierte Wirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin und Paris seien sich zur Zeit „in nichts einig“. ex.klusiv
Panzer für Europa (II)
Deutsche Rüstungsindustrie schmiedet neue Kampfpanzer-Allianz – ohne Frankreich. Damit könnte die deutsch-französische Rüstungskooperation endgültig Schiffbruch erleiden. Berlin priorisiert nationale Interessen.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Die deutsche Rüstungsindustrie arbeitet an einer neuen Kampfpanzer-Allianz und stellt damit ein milliardenschweres Leuchtturmprojekt der deutsch-französischen Rüstungskooperation in Frage. Einem aktuellen Bericht zufolge sind die Waffenschmieden Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall aktuell dabei, sich mit Leonardo (Italien), Saab (Schweden) und einem spanischen Unternehmen zu verbünden, um einen Nachfolgepanzer für den Leopard 2 zu entwickeln. Dies wurde bislang von KMW in Kooperation mit dem französischen Panzerbauer Nexter vorangetrieben; das Main Ground Combat System (MGCS), ein um einen Panzer der allerjüngsten Generation zentriertes High-Tech-Kampfsystem, sollte zum gemeinsam hergestellten Kernelement der Landstreitkräfte in Europa werden und die Verschmelzung der europäischen Rüstungsindustrie vorantreiben. Streitigkeiten begleiten das Vorhaben seit Jahren. Die neue Kampfpanzer-Allianz könnte nun sein Ende einläuten und womöglich auch das zweite deutsch-französische Großprojekt, das Future Combat Air System (FCAS), stoppen. Damit setzt sich der Verfall der Kooperation zwischen Berlin und Paris unter Kanzler Olaf Scholz fort; Scholz priorisiere, heißt es, „deutsche Interessen“. ex.klusiv
Deutsch-französische Konflikte
Die deutsch-französischen Konflikte um die Aufrüstung der EU eskalieren erneut im Streit um die europäische Flugabwehr. Der Bau eines gemeinsamen Kampfpanzers (MGCS) könnte scheitern.
PARIS/BERLIN (Eigener Bericht) – Anhaltender Streit zwischen Berlin und Paris bremst die eigenständige Aufrüstung der EU und führt zu neuen Differenzen im Konflikt um die NATO-Aspirationen der Ukraine. Zu Wochenbeginn hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Gegeninitiative zum deutschen Projekt einer europäischen Flugabwehr (ESSI, European Sky Shield Initiative) lanciert, das Berlin ohne Abstimmung mit Paris gestartet hatte – zum Schaden der französischen Rüstungsindustrie. Damit laufen in der EU zwei Versuche parallel, einen umfassenden Flugabwehrschild für Europa zu konstruieren. Nur mit Mühe konnten harte Auseinandersetzungen um den deutsch-französischen Kampfjet der sechsten Generation (FCAS) zumindest vorläufig beigelegt werden. Das Vorhaben, einen hochmodernen deutsch-französischen Kampfpanzer (MGCS) zu bauen, ist vom Scheitern bedroht, weil es massiv verschleppt wird und die deutsche Rüstungsindustrie bereits Alternativen produziert (Panther, Leopard 2A8). Im Streit um einen etwaigen NATO-Beitritt der Ukraine fällt Paris, von den Auseinandersetzungen mit Berlin entnervt, der Bundesregierung in den Rücken und stützt die Forderung, das Land in das Bündnis aufzunehmen. ex.klusiv
Eine neue Epoche der Konfrontation
Deutsch-französische Streitigkeiten verzögern gemeinsames Nachfolgeprojekt für den Leopard 2. Französische Experten sehen die bilateralen Beziehungen in einer tiefen Krise.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Das deutsch-französische Landkampfsystem MGCS, ein Nachfolgeprojekt für den Kampfpanzer Leopard 2, ist vom Scheitern bedroht. Wie das Bundesverteidigungsministerium in einem vertraulichen Bericht einräumt, haben Differenzen zwischen Berlin und Paris schon heute, kaum sechs Jahre nach dem offiziellen Start des Vorhabens, zu „mehrjährigen Verzögerungen im ursprünglichen Programmplan“ geführt. Die eigentlich für 2035 geplante Fertigstellung sei „nicht mehr realisierbar“; zu rechnen sei mit einer Indienststellung des MGCS frühestens im Jahr 2040. Deutsche Panzerbauer legen inzwischen Alternativen vor – Rheinmetall etwa den Kampfpanzer Panther; darüber hinaus ist inzwischen auch eine weitere Modernisierung des bewährten Leopard 2 zum Leopard 2A8 geplant. Deutsch-französische Streitigkeiten prägen die europäische Rüstungsbranche auch jenseits des MGCS, so etwa beim Kampfjet der nächsten Generation (FCAS) oder bei Berlins Plänen für ein neues europäisches Flugabwehrsystem. In Paris weisen Experten darauf hin, dass sich die Bundesregierung im Ukraine-Krieg nicht Frankreich, sondern vielmehr den USA angenähert hat, und warnen vor einer innereuropäischen „Epoche der Konfrontation“. ex.klusiv
Die strategische Souveränität der EU
Berlin und Paris streben größere Eigenständigkeit der EU gegenüber den USA an und rüsten massiv auf – auch, weil Deutschland in der Rivalität mit Washington schwere Rückschläge verzeichnet.
PARIS/BERLIN (Eigener Bericht) – Deutschland und Frankreich streben nach größerer „europäischer Souveränität“ und wollen die EU „als geopolitischen Akteur ... stärken“. Dies geht aus einer Deutsch-Französischen Erklärung hervor, die gestern in Paris anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages veröffentlicht wurde. Die Erklärung sieht weitere militärische Unterstützung für die Ukraine vor, „solange dies nötig ist“, kündigt neue Aufrüstungsschritte an und sieht deutsch-französische Manöver „im Indo-Pazifik“ vor. Hintergrund sind unter anderem gravierende Rückschläge der Bundesrepublik in der Rivalität mit den Vereinigten Staaten, darunter eine zunehmende militärische Abhängigkeit sowie die drohende Deindustrialisierung durch die Abwanderung von Produktionsstandorten in die USA. Wie der französische Publizist Emmanuel Todd urteilt, gehe es in den gegenwärtigen globalen Machtkämpfen – einem „beginnenden dritten Weltkrieg“ – auch „um Deutschland“. Bundeskanzler Olaf Scholz geht von der Entstehung einer „multipolaren Welt“ aus; in ihr sollen sich Deutschland und die EU als militärisch schlagkräftige Mächte eine führende Stellung sichern. ex.klusiv
Auf Kosten Frankreichs
Berliner Regierungsberater wollen Frankreichs faktischen Ausschluss vom geplanten europäischen Luftverteidigungssystem aufheben: „Geschlossenheit“ sei politisch zentral.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Frankreichs faktischer Ausschluss aus der deutschen Initiative zum Aufbau eines europäischen Luftverteidigungssystems soll dringend revidiert werden. Dies fordert die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer neuen Stellungnahme. Demnach soll die European Sky Shield Initiative (ESSI), die Mitte Oktober von 15 Staaten Europas unter deutscher Führung lanciert wurde, um „Offensivfähigkeiten“ ergänzt werden, die Paris stellen könne – zum Nutzen der französischen Rüstungsindustrie. Die bisher vorgesehenen Luftverteidigungssysteme – IRIS-T SLM, Patriot, Arrow 3 – entstammen durchweg deutscher, israelischer oder US-amerikanischer Produktion. Französische Kritiker weisen darauf hin, dass die von Frankreich und Italien entwickelten Luftverteidigungssysteme SAMP/T und Aster Block 1 NT recht breite Entfernungsspektren abdeckten – und dass sie unter Umständen alle vorgesehenen Systeme aus Deutschland, Israel und den USA ersetzen könnten. Mit seiner aktuellen Auswahl verhindere Berlin den Aufbau einer eigenständigen europäischen Luftverteidigung – zugunsten des Profits der deutschen Rüstungsindustrie. ex.klusiv
Die deutsch-französische „Freundschaft“
Kanzler Olaf Scholz reist zu Krisentreffen mit Präsident Emmanuel Macron nach Paris. Deutsch-französische Streitigkeiten schwellen bezüglich immer mehr Themen an.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Auf einem Krisentreffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Kanzler Olaf Scholz die seit geraumer Zeit anschwellenden deutsch-französischen Streitigkeiten lindern. Scholz soll morgen in der französischen Hauptstadt mit Macron zusammentreffen – anstelle der ursprünglich geplanten Regierungskonsultationen, die in der vergangenen Woche wegen zunehmender Konflikte zwischen den beiden Ländern kurzfristig abgesagt wurden. Streit herrscht zwischen Berlin und Paris unter anderem im Rüstungsbereich; so ist die Zukunft sowohl des Luftkampfsystems FCAS, des wichtigsten und teuersten Rüstungsprojekts in der EU, als auch des geplanten Kampfpanzers MGCS ungewiss. Beide gelten als deutsch-französische Vorhaben von zentraler Bedeutung. Streit gibt es zwischen Deutschland und Frankreich auch in Energiefragen – etwa bezüglich der MidCat-Pipeline, die Erdgas aus Spanien in Richtung Deutschland transportieren sollte, nun aber an französischen Widerständen gescheitert ist. Besonderen Unmut hat in Frankreich Berlins Alleingang mit dem 200-Milliarden-Euro-Schutzschirm („Doppelwumms“) ausgelöst. ex.klusiv
Streit um das Luftkampfsystem
Das bedeutendste Rüstungsprojekt in der EU, ein Luftkampfsystem um einen Kampfjet der sechsten Generation, könnte scheitern. Auf Erfolgskurs ist dagegen die britische Konkurrenz.
PARIS/BERLIN (Eigener Bericht) – Das bedeutendste und teuerste Rüstungsprojekt in der EU steht möglicherweise vor dem Scheitern. Dabei handelt es sich um das FCAS (Future Combat Air System), ein Luftkampfsystem, das um einen High-Tech-Kampfjet der sechsten Generation herum konzipiert ist, Drohnen und Drohnenschwärme umfasst und mit Hilfe der Cloud-Technologie und Künstlicher Intelligenz (KI) vernetzt ist. Es wird gemeinsam von Deutschland, Frankreich und Spanien entwickelt. Zwischen den beteiligten Konzernen kommt es zu Streit: Dassault (Frankreich) sieht sich durch die Integration des spanischen Airbus-Ablegers in das Projekt benachteiligt und verlangt jetzt eine klare Führungsrolle, die Airbus Defence and Space (Deutschland) dem Unternehmen bisher nicht zugestehen will. Schon jetzt sind durch die Differenzen Verspätungen entstanden, die die Einsatzbereitschaft des FCAS über das ursprünglich geplante Jahr 2040 hinaus verzögern. Aktuell führen sie dazu, dass die spanische Luftwaffe den Kauf von US-Kampfjets des Typs F-35 fordert; dies sei nötig, um die eigene Kampfkraft im kommenden Jahrzehnt sicherzustellen, heißt es. Als Alternative käme ein britisches FCAS-System („Tempest“) in Betracht. ex.klusiv
Der nächste Kampf um die „Schuldenregeln“
Wegen des Kampfs gegen die Coronakrise und der gewaltigen Kosten der „grünen Transformation“ zeichnen sich neue Auseinandersetzungen um den EU-„Stabilitätspakt“ ab.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Nach dem ersten Treffen der EU-Finanzminister unter Beteiligung des neuen Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP) ist eine Debatte über den künftigen finanzpolitischen Kurs der Eurozone entbrannt. Thema der Debatte ist eine „Reform der Schuldenregeln“, die mit Blick auf die notwendigen Investitionen zur Überwindung der Coronakrise und zur Finanzierung der „grünen Transformation“ von vielen für notwendig gehalten wird; die Rede ist von einem Bedarf von „Hunderten Milliarden Euro“. In der Bundesrepublik werden Erleichterungen bei den Schuldenregeln traditionell abgelehnt; die neue Regierung hat sich freilich noch nicht endgültig festgelegt. Beobachter mutmaßen, im Sinne einer informellen Arbeitsteilung auf EU-Ebene könne Österreich in die Rolle des finanzpolitischen „Hardliners“ schlüpfen, um es Deutschland zu ermöglichen, sich vorteilhaft als „Moderator“ zu präsentieren. Allerdings gerät Berlin schon jetzt mit Paris in Konflikt, das seine derzeitige EU-Ratspräsidentschaft nutzen will, um die Sparzwänge in der EU zu lockern. Von „unterschiedlichen Visionen der Zukunft der europäischen Ökonomie“ ist die Rede. ex.klusiv
GERMAN-FOREIGN-POLICY.com
Informationen zur deutschen Außenpolitik: Nachrichten + Interviews + Analysen + Hintergründe