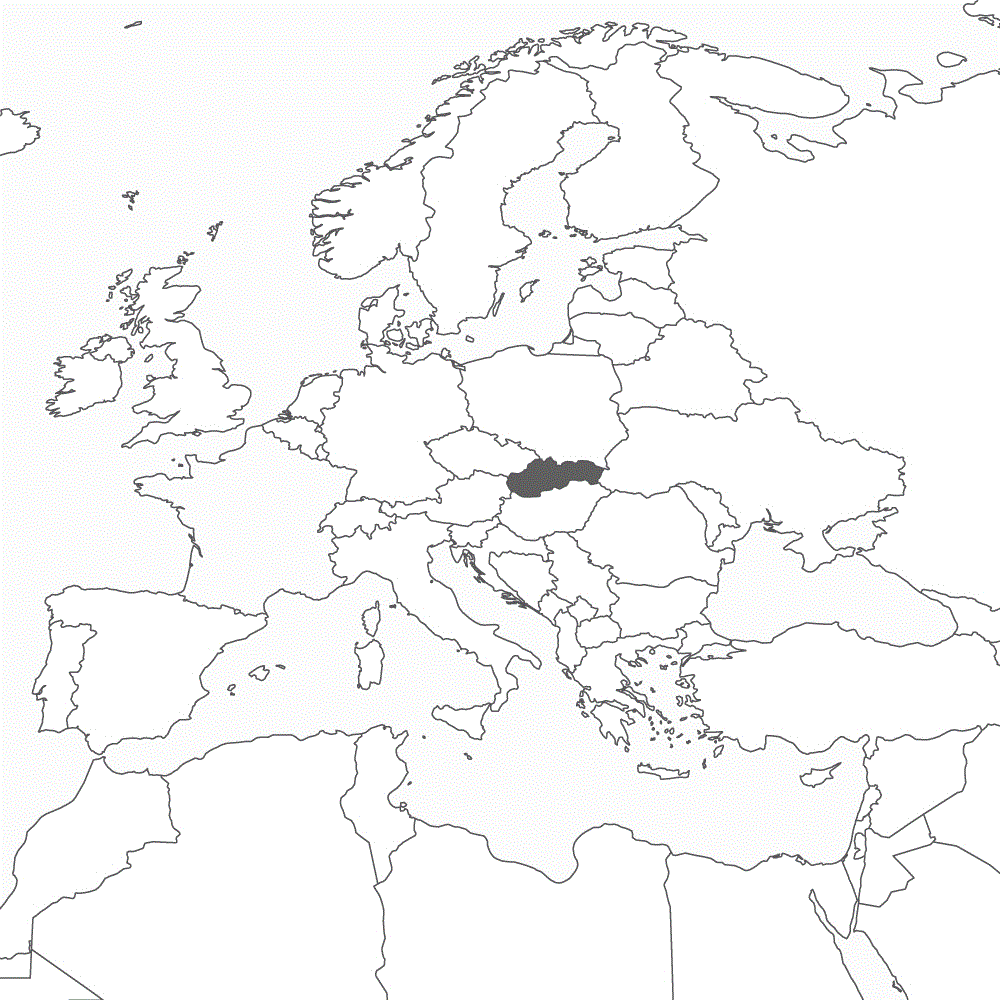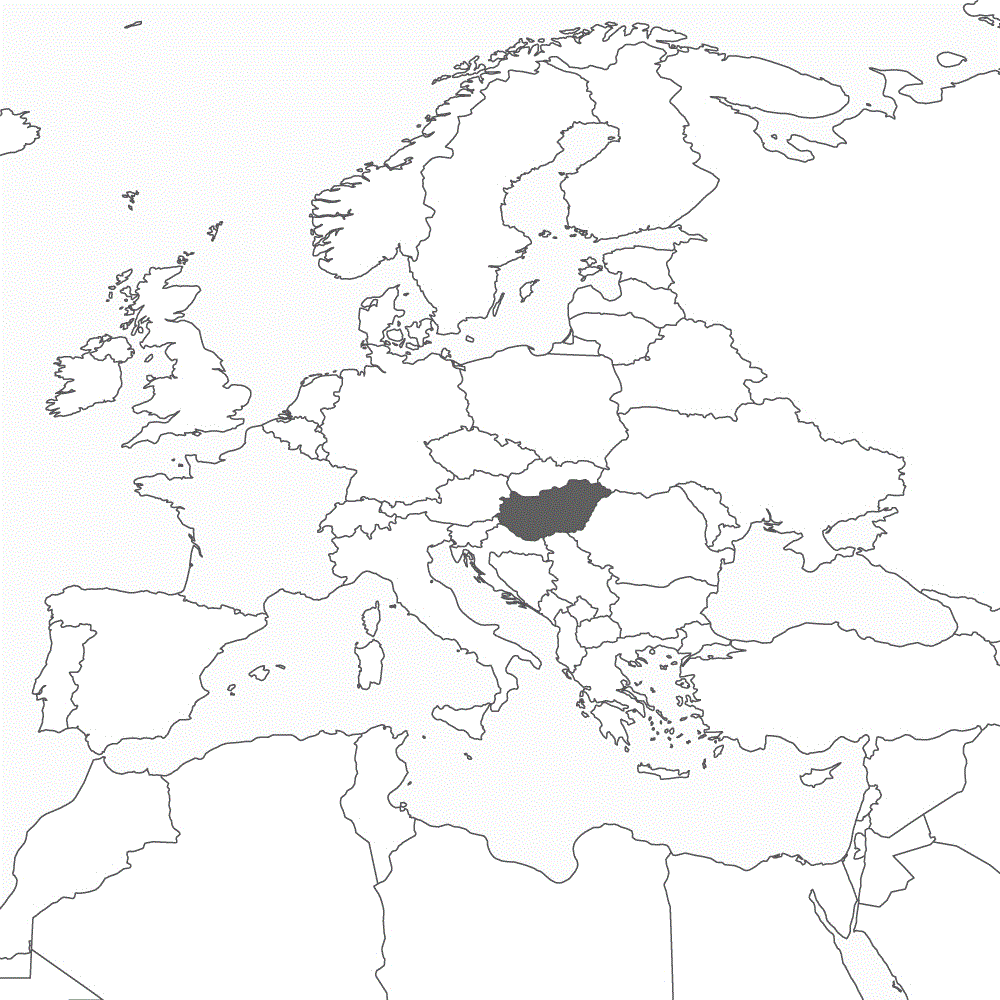„Alarmbereitschaft“ wegen der Slowakei
Die Bundesrepublik erhöht den Druck auf die Slowakei. Die Ursache: Die künftige Regierung des wirtschaftlich von Deutschland abhängigen Landes strebt eine nicht wirtschaftsliberale, zugleich russlandfreundliche Politik an.
BERLIN/BRATISLAVA (Eigener Bericht) – Die Bundesrepublik erhöht nach der Parlamentswahl in der Slowakei den Druck auf deren künftige Regierung. Diese setzt sich für eine nicht mehr wirtschaftsliberale und zudem eher russlandfreundliche Politik ein; ihr künftiger Premierminister Robert Fico erklärt, sein Außenminister werde „nicht mehr für ausländische Interessen sprechen“ – insbesondere mit Blick auf die Russlandpolitik. Die Waffenlieferungen an die Ukraine, bei denen Bratislava gemessen am Bruttoinlandsprodukt eine vordere Position innehatte, wurden bereits gestoppt. Fico fordert, auch EU- und NATO-Verbündete müssten die „volle Souveränität“ der Slowakei respektieren. Ein einflussreicher Autor des Berliner Tagesspiegels beschimpft den künftigen slowakischen Regierungschef, er sei „im Grunde ... ‘nationalsozialistisch‘“; die sozialdemokratische EU-Partei SPE, in der die deutsche SPD eine starke Rolle spielt, hat Ficos Partei Smer-SSD und seinen Koalitionspartner Hlas-SD bereits suspendiert. Im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde Fico kurz nach seinem Wahlsieg als „eine Art trojanisches Pferd Putins“ bezeichnet. ex.klusiv
Die zweite Rückkehr des „Populisten“
In der Slowakei droht Berlin der Verlust eines Verbündeten im Ukraine-Krieg: Wahlfavorit Robert Fico will die Waffenlieferungen an Kiew beenden, lehnt die Russland-Sanktionen ab und will enger mit China kooperieren.
BRATISLAVA/BERLIN (Eigener Bericht) – Mit der Parlamentswahl in der Slowakei am morgigen Samstag droht der Bundesregierung der Verlust eines wichtigen Verbündeten im Ukraine-Krieg. In den Umfragen führt die Partei SMER des ehemaligen Ministerpräsidenten Robert Fico, der gute Aussichten hat, eine Regierungskoalition bilden zu können – zum vierten Mal nach 2006 und 2012. Zwar geht seine Popularität vor allem auf die soziale und wirtschaftliche Misere zurück, in die das Land unter den vergangenen Regierungen gestürzt ist. Aus Sicht Berlins und des Westens wiegt jedoch schwer, dass Fico einen Kurswechsel in der Ukrainepolitik in Aussicht stellt; so will er nicht nur die Waffenlieferungen an die Ukraine beenden, er lehnt auch die EU-Sanktionen gegen Russland ab. Zudem favorisiert SMER eine engere Zusammenarbeit unter anderem mit China und Kuba. Die derzeitige prowestliche Präsidentin der Slowakei, Zuzana Čaputová, erklärt den Urnengang zur „Schicksalswahl“. Fico und seine Partei SMER wurden wegen ihrer abweichenden außenpolitischen Orientierung bereits während ihrer früheren Regierungsjahre in Deutschland massiv attackiert. Ähnliches zeichnet sich nun erneut ab. ex.klusiv
BERLIN/BUDAPEST (Eigener Bericht) - 75 Jahre nach einem deutschen Dekret zur Okkupation von Teilen der Slowakei durch Ungarn erstarken erneut Autonomiebestrebungen in dem damaligen Okkupationsgebiet. Am 2. November 1938 hatten Berlin und Rom - gemäß einer Zusatzerklärung zum Münchner Diktat - Ungarn weite Gebiete der Slowakei zugeschlagen. Vorausgegangen waren völkische Autonomiebestrebungen der dortigen ungarischsprachigen Minderheit; am 5. November 1938 marschierten ungarische Truppen dann in das Nachbarland ein. Mit Hilfe seiner völkischen - am deutschen Modell orientierten - Minderheitenpolitik interveniert Budapest seit Jahren erneut in der Slowakei und ruft dort ernste Spannungen hervor. Gleichzeitig kommt es auch in Rumänien zu Autonomieforderungen der ungarischsprachigen Minderheit, die sich kürzlich in Massenprotesten artikulierten. Sie werden - genauso wie die Autonomiebestrebungen in der Slowakei - von einer Vorfeldorganisation der deutschen Außenpolitik unterstützt. Auch in diesem Fall geht es um ein Gebiet, über dessen Autonomiestreben ehedem das Deutsche Reich entschied - im Zweiten Wiener Diktat. Der Beginn der völkischen Neuordnung Ost- und Südosteuropas durch das Deutsche Reich jährt sich in diesen Tagen zum 75. Mal. ex.klusiv
BRATISLAVA/BERLIN (Eigener Bericht) - Auseinandersetzungen um den bevorstehenden Verkauf eines der größten Stahlwerke Osteuropas verdeutlichen eine außenpolitische Umorientierung in der Slowakei. Der deutsche ThyssenKrupp-Konzern ist als möglicher Käufer des riesigen Stahlwerks in Košice (Ost-Slowakei) im Gespräch. Das Werk ist der größte Arbeitgeber des Landes und besitzt - auch aufgrund seiner geographischen Nähe zu den Erzlagerstätten der Westukraine - strategische Bedeutung. Die Entscheidung über den Käufer steht zu einer Zeit an, da die neue Regierung in Bratislava sich neue ökonomische und außenpolitische Spielräume gegenüber Deutschland verschaffen will. Mittel dazu sind eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich und Russland - als Käufer des Stahlwerks in Košice ist auch ein russischer Konzern im Gespräch - und Pläne zur Rückverstaatlichung des slowakischen Erdgasmonopolisten SPP, auf den bis heute die deutsche E.ON Ruhrgas AG maßgeblichen Einfluss besitzt. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico knüpft mit seiner vorsichtigen Opposition gegen Berlin an seine erste Amtszeit an - und erhält in Deutschland eine entsprechend schlechte Presse. ex.klusiv
Der mühsame Weg nach Westen Wien 2012 (Promedia) 248 Seiten 17,90 Euro ISBN 978-3-85371-349-5 ex.klusiv
BRATISLAVA/BERLIN (Eigener Bericht) - Bei den slowakischen Parlamentswahlen an diesem Wochenende steht die Berlin gegenüber loyale liberalkonservative Regierungskoalition vor einer dramatischen Niederlage. Selbst die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung, die starke Sympathien für die bisherige Ministerpräsidentin und Favoritin Berlins, Iveta Radičová, hegt, rechnet mit einem "klare(n) Sieg" von Radičovás Amtsvorgänger Robert Fico. Fico wiederum war bereits während seiner ersten Amtszeit von 2006 bis 2010 nicht nur von Vorfeldorganisationen der Berliner Außenpolitik, sondern auch von deutschen Medien, Wirtschaftsverbänden und offiziellen Stellen scharf attackiert worden, weil er den Ausverkauf slowakischer Staatsbetriebe gestoppt und Versuche einer eigenständigen Außenpolitik unternommen hatte. Die Bundesregierung hatte ihm 2006 sogar den üblichen Antrittsbesuch verweigert. Beobachter rechnen damit, dass Fico sich erneut bemühen wird, Bratislavas Abhängigkeit von Berlin zu verringern. Neue Konflikte zwischen der Slowakei und der Bundesrepublik seien deswegen, heißt es, keineswegs unwahrscheinlich. ex.klusiv
BRATISLAVA/BERLIN (Eigener Bericht) - Nach dem Bruch der Regierung der Slowakei unter der Last deutscher Forderungen erhöht Berlin den Druck auf den aussichtsreichsten Kandidaten bei den kommenden dortigen Parlamentswahlen. Die bisherige Wunschpartnerin der Bundesregierung, die liberalkonservative Ministerpräsidentin Iveta Radičová, ist letzte Woche gestürzt worden; innerhalb ihrer Regierung war das von Berlin geforderte "Ja" zu den Änderungen am "Euro-Rettungsschirm" (EFSF) nicht durchsetzbar. Radičovás Amtsvorgänger Robert Fico, der nun auch ihr Nachfolger werden könnte, stößt in Berlin auf Widerstand, da er den außenpolitischen Spielraum seines Landes zu erweitern sucht und den Interessen deutscher Konzerne, die die Slowakei bereits seit Jahren als Niedriglohnstandort nutzen, nicht in vollem Umfang entspricht. Die slowakische Partei SaS, die die Zustimmung zum EFSF verweigerte und damit den Sturz der prodeutschen Regierung herbeiführte, wird von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung unterstützt. Dabei stärkte die Stiftung zuletzt Euro-kritische Positionen, wie sie jüngst auch in Teilen der FDP zu erkennen waren. Die SaS sucht dennoch mittlerweile, enttäuscht von der FDP, Kontakt zur extrem rechten FPÖ. ex.klusiv
BRATISLAVA/BERLIN (Eigener Bericht) - Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung warnt vor einem Sturz der Regierung in der Slowakei. Die aktuellen Auseinandersetzungen in Bratislava um die Wahl eines neuen Generalstaatsanwalts könnten mit dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Iveta Radičová enden, heißt es in einer aktuellen Analyse der Stiftung. Radičovás Kandidatur und ihr Wahlsieg im Sommer 2010 waren von mehreren deutschen Parteienstiftungen gefördert und von der deutschen Regierung begrüßt worden, da sie den missliebigen Ministerpräsidenten Robert Fico ablöste. Fico, von der staatsfinanzierten Deutschen Welle als "Hugo Chávez Europas" bezeichnet, verweigerte sich politischen Anliegen Berlins und Forderungen deutscher Unternehmen, darunter die Privatisierung slowakischer Staatsbetriebe. Er könnte die Macht zurückerobern, falls die Wahl des höchst einflussreichen Generalstaatsanwalts an diesem Freitag nicht nach Radičovás Wunsch verläuft. Hintergrund der aktuellen Streitigkeiten sind unter anderem Forderungen deutscher Wirtschaftskreise, die den amtierenden Generalstaatsanwalt ablehnen. ex.klusiv
BERLIN/PRAG/WARSCHAU (Eigener Bericht) - Das deutsche Drängen zur Übernahme des Euro durch die östlichen EU-Staaten stößt auf Widerstand. Berlin hat in den vergangenen Monaten seinen Druck auf mehrere mittelosteuropäische Regierungen verstärkt, um diese zu einem baldigen Beitritt zur Eurozone zu bewegen - ohne Erfolg. Man werde selbst entscheiden, "ob und wann wir den Schritt gehen wollen", erklärt der tschechische Ministerpräsident Petr Nečas. Die europäische Gemeinschaftswährung sei ohnehin ein "ambitioniertes, aber unfertiges Projekt", urteilt der Gouverneur der polnischen Zentralbank. In politischen Führungskreisen in der Slowakei werden inzwischen sogar Forderungen laut, aus der Eurozone auszutreten. Hintergrund ist, dass etwa Polen per Währungsabwertung seine Wirtschaft über die Krise retten konnte, während die südlichen Euroländer deutschen Exportoffensiven hilflos ausgeliefert waren und in den Ruin getrieben wurden. Nach dem Beitritt Estlands zur Eurozone Anfang des Jahres ist die Ausdehnung der Gemeinschaftswährung damit praktisch zum Stillstand gekommen. ex.klusiv
BRATISLAVA/BERLIN (Eigener Bericht) - Vor den Parlamentswahlen in der Slowakei an diesem Wochenende intensiviert Berlin seine Unterstützung für die slowakische Opposition. Mehrere parteinahe Stiftungen unterstützen oppositionelle Organisationen und üben deutliche Kritik an der Regierung. Über die Friedrich-Naumann-Stiftung haben Spitzenkandidaten der Opposition Zugang zur Bundesregierung erhalten. Ursache der deutschen Einmischung in Bratislava sind fortdauernde Widerspenstigkeiten der aktuellen slowakischen Regierung, die sich eine relative Eigenständigkeit auch in ihrer Außenpolitik zu bewahren sucht und deshalb mit der EU-Hegemonialmacht in ernste Konflikte gerät. Bereits in den 1990er Jahren hatte die Slowakei gegen die deutsche Hegemonie in Osteuropa opponiert, bis die damalige Regierung Mečiar unter starkem Druck aus Deutschland und den Vereinigten Staaten abgewählt wurde. Seit im Jahr 2006 erneut auf Eigenständigkeit bedachte Kräfte in Bratislava an die Regierung gelangt sind, nehmen auch die Pressionen aus Berlin wieder zu. ex.klusiv
GERMAN-FOREIGN-POLICY.com
Informationen zur deutschen Außenpolitik: Nachrichten + Interviews + Analysen + Hintergründe