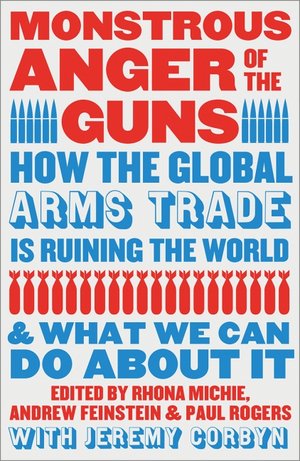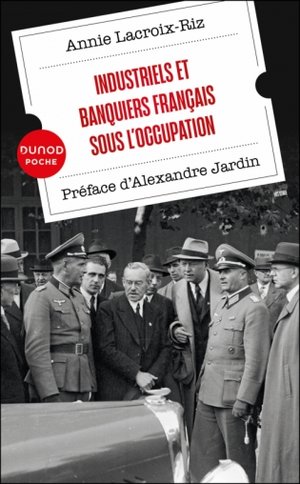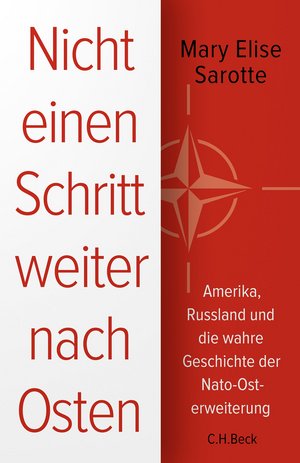Rezension: Alternative Defence Review
Die britische Eisenbahner- und Transportarbeitergewerkschaft RMT und die Campaign for Nuclear Disarmament (CND) präsentieren Konzepte und konkrete Schritte für Alternativen zur aktuellen Rüstungs- und Kriegspolitik.
LONDON Rüsten, rüsten, rüsten – das ist die Devise, an der zur Zeit die Regierungen der europäischen NATO-Staaten ihre gesamte Politik ausrichten. Das trifft auf Deutschland nicht anders zu als auf Frankreich oder Großbritannien. Dabei führt die exzessive Fokussierung staatlichen Handelns auf das Militär und die Rüstung zu vielfältigen Schäden, die selbst dann immens sind, wenn es – noch – nicht zum großen Krieg kommt: Das zeigt beispielhaft die Alternative Defence Review, eine kritische Analyse der britischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die im Mai von der Eisenbahner- und Transportarbeitergewerkschaft RMT und der Campaign for Nuclear Disarmament (CND) gemeinsam vorgelegt wurde. Das Papier ist in den britischen Gewerkschaften breit rezipiert worden. Aus ihm geht hervor, dass die Londoner Aufrüstungspolitik weder Sicherheit schafft noch sich auf Landesverteidigung beschränkt; dass sie vielmehr international weiter Spannungen schürt und auf allen Ebenen schadet: vom Klima, das sie zusätzlich belastet, über die Ungleichheit, die sie verstärkt, bis hin zur Armut, die sie verschlimmert. Die Erkenntnisse ließen sich ohne weiteres auf die deutschen Verhältnisse übertragen. ex.klusiv
Rezension: Gewerkschaften in der Zeitenwende
Ulrike Eifler beleuchtet in einem Sammelband die Lage der Gewerkschaften inmitten der aktuellen Militarisierung, deren Folgen für Arbeitswelt und Sozialstaat und die Möglichkeiten für den Widerstand dagegen.
„Kriegsvorbereitungen und vor allem der Krieg selbst gehen stets mit enormen Angriffen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden Klassen einher“: Das ist, schreibt Ulrike Eifler in dem von ihr herausgegebenen, soeben erschienenen Sammelband „Gewerkschaften in der Zeitenwende“, eine der Lehren, die man aus der Geschichte ziehen kann. Das gilt zum einen, weil auf den Schlachtfeldern der Vergangenheit „nie Verteidigungsminister, Militärexperten, Militärhistoriker oder Rüstungsfabrikanten gekämpft“ haben, immer aber „der Mann der Arbeit“, wie Eifler konstatiert. Es gilt zum anderen, weil Kriege stets den Abbau von Arbeitsrechten, von Löhnen und von existenziellen Sicherheiten mit sich bringen – „insbesondere für diejenigen, die am meisten darauf angewiesen sind“. Gewerkschaften, betont Eifler, selbst Gewerkschafterin in Würzbürg, haben schon aus diesen Gründen ein „hervorgehobenes Interesse an einer friedlichen Welt“. Vor diesem Hintergrund fragt sie in ihrem facettenreichen Sammelband zunächst nach „den Auswirkungen der aktuellen Kriegsvorbereitungspolitik auf die Welt der Arbeit“. ex.klusiv
Rezension: Monstrous Anger of the Guns
Rhona Michie, Andrew Feinstein und Paul Rogers beleuchten den globalen Waffenhandel, seine Folgen für die betroffenen Gesellschaften, für das Klima und für die Diplomatie sowie Möglichkeiten der Gegenwehr.
Es war einer der krassesten Fälle von Korruption in der Geschichte des internationalen Waffenhandels, möglicherweise sogar das Geschäft mit der höchsten Bestechungssumme überhaupt: der Al Yamamah-Deal, den Großbritannien und Saudi-Arabien im Jahr 1985 schlossen. Riad zahlte 43 Milliarden Pfund für 96 Kampfjets des Modells Panavia Tornado, zahlreiche weitere Militärflugzeuge, diverse Raketen, Granaten und mehr. Zugleich sagte Saudi-Arabien zu, erhebliche Mengen Erdöl an Großbritannien zu liefern. Dass London den Deal schließen konnte, war nicht selbstverständlich; die Konkurrenz aus Frankreich war stark. Den Ausschlag gab letztlich, dass Schmiergelder in Rekordhöhe von sechs Milliarden Pfund flossen. Teile davon gingen an den Tornado-Lieferanten BAE Systems und an Mark Thatcher, den Sohn der damaligen britischen Premierministerin. Ein Sohn des damaligen saudischen Verteidigungsministers erhielt einen zivilen BAE-Jet und eine Milliarde Pfund. Ein Teil des Geldes landete auf Umwegen, so berichten es Rhona Michie, Andrew Feinstein und Paul Rogers in ihrem Sammelband „Monstrous Anger of the Guns“, bei zweien der Attentäter vom 11. September 2001. ex.klusiv
Rezension: Industriels et banquiers français sous l’occupation
Annie Lacroix-Riz untersucht die Kollaboration der Führungsspitzen der französischen Wirtschaft mit den deutschen Besatzern in den Jahren von 1940 bis 1944. Es ging um Profite in einem geeinten Europa unter deutscher Führung.
Anfang September 1941 stellten einige der einflussreichsten Industriellen und Bankiers des deutsch besetzten Frankreichs ihre Haltung zu den Plänen des NS-Reichs für die Neuordnung des europäischen Kontinents klar. Auf einem Treffen mit einem hochrangigen deutschen Wirtschaftsfunktionär in Paris meldete sich nach einleitenden Worten von Pierre Pucheu, einem Mann der Wirtschaft, der kurz zuvor zum Innenminister des Vichy-Regimes ernannt worden war, Henri Ardant zu Wort. Der Chef der mächtigen Société Générale erklärte im Einvernehmen mit Pucheu und anderen französischen Unternehmern, man setze entschlossen auf Deutschlands Vorstellungen für Europa, nicht zuletzt darauf, dass unter Berliner Führung „die Zollgrenzen beseitigt und eine einheitliche Währung für Europa geschaffen“ würden. Die Stellungnahme sei bemerkenswert, hieß es anschließend in einem streng vertraulichen Bericht eines deutschen Teilnehmers – umso mehr, als Ardant gegenwärtig als „der erste und bedeutendste der französischen Bankiers“ gelten müsse. Aus dem Bericht zitiert in ihrem umfassenden, nun in einer neu überarbeiteten zweiten Auflage publizierten Werk „Industriels et banquiers français sous l’occupation“ („Französische Industrielle und Bankiers während der Besatzungszeit“) die französische Historikerin Annie Lacroix-Riz. ex.klusiv
Rezension: Der Tech-Krieg
Wolfgang Hirn analysiert den Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und China um die globale technologische Führungsposition und die Stellung Europas, das technologisch längst zurückfällt – ohne es wirklich zu realisieren.
Aktueller könnte es kaum sein, das Motto, mit dem der Publizist Wolfgang Hirn das zehnte Kapitel seines jüngsten Buchs „Der Tech-Krieg“ überschrieben hat. „Der Wettbewerb um nationale Stärke ist auch ein Wettbewerb um Talente“, lautet es: „Wer die besten Talente an sich binden kann, wird in diesem Wettbewerb einen Vorteil haben.“ Denn die komplexen modernen Technologien, die allein – das stellt Hirn schon in der Einleitung zu seinem Buch fest – „eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und ein starkes Militär“ möglich machen, müssen erdacht, praktisch entwickelt und anschließend produziert werden; und dafür benötigt man, wie könnte es anders sein, hochqualifiziertes Personal in großer Zahl. Manche halten die Säuberungen, denen US-Präsident Donald Trump die US-Elitehochschulen unterzieht, und die immer drastischeren Schikanen gegenüber ausländischen Studierenden für den auf lange Sicht vielleicht schwersten Fehler des Mannes, der Amerika „great“ machen will, aber möglicherweise gerade dabei ist, seine Zukunft zu ruinieren. Kaum jemand hat ein Land als Studien- und Forschungsstandort schneller unattraktiv gemacht als Trump die USA. Das eingangs zitierte Motto, nebenbei, stammt von Chinas Präsident Xi Jinping. ex.klusiv
Rezension: „Meuterei“
Peter Mertens analysiert die Revolte des Globalen Südens gegen die westliche Dominanz und die parallel dazu stattfindenden Revolten innerhalb des Südens und des Westens gegen Armut und Ausbeutung.
Die Welt sei in Aufruhr, hielt Fiona Hill, Ex-Mitarbeiterin im Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten, im Mai vergangenen Jahres in einer Rede in der estnischen Hauptstadt Tallinn fest. In zahlreichen Ländern des Globalen Südens kristallisiere sich in „Eliten und Bevölkerungen“ wachsender Widerstand gegen die Hegemonie des Westens bzw. gegen die Hegemonie der Vereinigten Staaten heraus. Die Überzeugung setze sich durch, der Westen habe dem Süden „in einer Zeit der Schwäche“ ein internationales System „aufgenötigt“, das seinen Bedürfnissen, seinen Interessen nicht gerecht werde. Stattdessen dominierten die transatlantischen Mächte „den internationalen Diskurs“. Das jüngste Beispiel, räumte Hill ein, sei der Ukraine-Krieg. In ihm gehe es nach Auffassung vieler im Globalen Süden nicht darum, die Ukraine, sondern vielmehr die globale Dominanz des Westens zu retten, die Russland mit dem Krieg offen in Frage gestellt habe. Das sei denn auch die Ursache, wieso die Russland-Sanktionen keine Unterstützung im Globalen Süden erhielten. Dort tobe zur Zeit vielmehr „eine Meuterei“ – „eine Meuterei gegen das, was sie als den kollektiven Westen ansehen“. ex.klusiv
Rezension: Nicht einen Schritt weiter nach Osten
Mary Elise Sarotte zeichnet die Verhandlungen über die deutsche Einheit und die Frage der NATO-Ostausdehnung im Jahr 1990 nach.
Das Versprechen an die Sowjetunion, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, hat es nie gegeben? Westdeutsche und US-amerikanische Politiker haben dies in den Verhandlungen über die deutsche Einheit der sowjetischen Seite, die das Vorrücken des westlichen Bündnisses in Richtung Moskau verhindern wollten, nie in Aussicht gestellt? Man kennt sie, diese Mythen, die jahrzehntelang von interessierten Kreisen in Deutschland und anderen – vor allem westlichen – Ländern verbreitet wurden. Mary Elise Sarottes Buch „Nicht einen Schritt weiter nach Osten – Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung“ räumt mit einigen dieser Mythen auf. Sie zeichnet dazu die Verhandlungen zwischen Bonn und Washington untereinander als auch die Verhandlungen dieser Regierungen auf der einen und Moskau auf der anderen Seite detailliert nach – von der frühen Zusage des damaligen Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher, es werde „eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten ... nicht geben“, bis zu den mageren Zusagen des 2+4-Vertrags, denen zufolge auf dem Gebiet der ehemaligen DDR keine NATO-Truppen stationiert werden dürfen. Wirklich neu sind ihre Erkenntnisse über die komplexe Entwicklung des Jahres 1990 freilich nicht. ex.klusiv
Rezension: Das zweite Turnier der Schatten
David X. Noack schildert die Einflusskämpfe zwischen Großbritannien, der Sowjetunion und Deutschland in den Jahren von 1919 bis 1933 in Zentralasien.
Zentralasien gehört nicht zu den Weltregionen, die im Zentrum der öffentlichen Debatte und der Publizistik in Deutschland stehen. Gelegentlich wird es von Politikern thematisiert, wenn die Bundesrepublik und die EU einmal mehr versuchen, sich dort im Einflusskampf gegen Russland und China zu behaupten. Einige kennen das Great Game, das Große Spiel, oder, im russischen Sprachgebrauch, das Turnier der Schatten: den erbittert geführten Einflusskampf zwischen Großbritannien und Russland im Zentralasien des 19. Jahrhunderts. Er entbrannte, als London von seiner Kolonie Indien aus seine Fühler in Richtung Norden ausstreckte, während Russland aus seinen Kerngebieten in Richtung Süden – eben nach Zentralasien – vorzustoßen begann. Im Unterschied zum Einflusskampf des 19. Jahrhunderts ist über die spätere Rivalität zwischen Großbritannien, der Sowjetunion und Deutschland in Zentralasien nach dem Ersten Weltkrieg kaum etwas bekannt – sehr zu Unrecht, wie die jetzt publizierte umfassende Analyse des Historikers David X. Noack zeigt. Noack beschreibt die Aktivitäten der in Zentralasien rivalisierenden Mächte für die Jahre von 1919 bis 1933 in seinem tief recherchierten Buch „Das zweite Turnier der Schatten“. ex.klusiv
Rezension: Der verschwiegene Völkermord
Aert van Riel schildert Vorgeschichte, Verlauf und Folgen des Maji-Maji-Krieges (1905 bis 1908) in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika.
Die „blutige Hand“ wird Carl Peters in Tansania bis heute genannt – oder, auf Kiswahili, „mkono wa damu“. Peters war 1884 Mitgründer der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation“. Einer, dessen Leute Perlen, Stoffe und Alkohol im Gepäck hatten, um sogenannte Verträge unterschreiben zu lassen – die Gewehre stets im Anschlag. In seinem Buch „Der verschwiegene Völkermord“ zeichnet Aert van Riel Vorgeschichte, Verlauf und Folgen des Maji-Maji-Krieges nach. Historiker gehen von bis zu 300.000 Toten zwischen 1905 und 1908 in der damaligen deutschen Kolonie Ostafrika aus, im Kriegsgebiet löschte die deutsche Kolonialmacht etwa ein Drittel der Bevölkerung aus. Für das Buch sprach Aert van Riel, derzeit Politischer Referent für Antirassismuspolitik beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, auch vor Ort mit Diplomaten, Wissenschaftlern und Aktivisten. Er zeigt auf: Während in Deutschland noch immer umstritten ist, die Verbrechen als Völkermord zu brandmarken, finden in Tansania regelmäßig Gedenkveranstaltungen statt; die antikolonialen Kämpfer gelten als Helden. ex.klusiv
Rezension: Le choix de la défaite
Annie Lacroix-Riz analysiert die umfassende Orientierung einflussreicher Segmente der französischen Eliten auf Deutschland in den 1930er Jahren und den fließenden Übergang in die Kollaboration.
„Der Tag wird kommen“, schrieb der französische Historiker Marc Bloch im April 1944, „und das vielleicht schon bald, an dem es möglich sein wird, Licht in die Machenschaften zu bringen, die bei uns von 1933 bis 1939 zugunsten der Achse Berlin-Rom getrieben wurden, um ihr die Herrschaft über Europa zu übertragen“. Bloch, der sich der Résistance angeschlossen hatte, um gegen das deutsche Besatzungsregime zu kämpfen, war kurz zuvor, am 8. März, in Lyon von der Gestapo festgenommen, inhaftiert und schwer gefoltert worden. Den Tod vor Augen, trieb ihn um, was er schon im Sommer 1940, kurz nach Frankreichs Kriegsniederlage gegen das Deutsche Reich, in seiner Schrift L’étrange défaite (Die seltsame Niederlage) konstatiert hatte: dass nämlich die französischen Eliten – Militärs, Politiker, Publizisten, insbesondere aber Industrielle – bereit gewesen seien, „eigenhändig das gesamte Gebäude unserer Allianzen und unserer Partnerschaften zu zerstören“, nur um zur offenen Kollaboration mit den Deutschen überzugehen. Der Kollaboration fiel, nach so vielen anderen, auch Bloch zum Opfer: Die Nazis brachten ihn am 16. Juni 1944 um. ex.klusiv
GERMAN-FOREIGN-POLICY.com
Informationen zur deutschen Außenpolitik: Nachrichten + Interviews + Analysen + Hintergründe