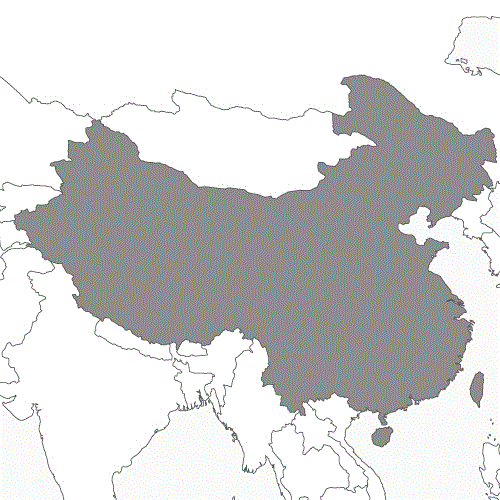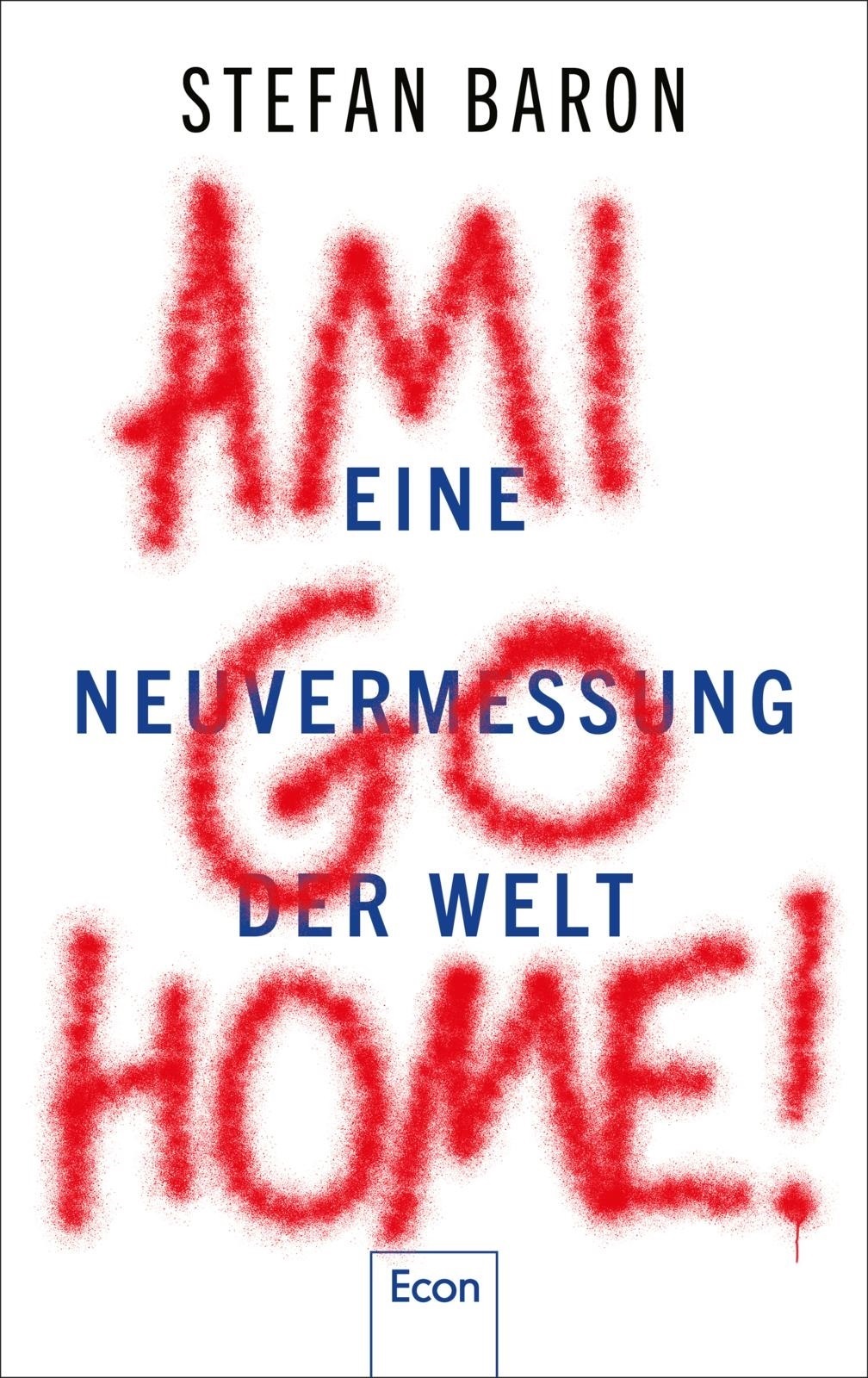Handlungsempfehlungen an die nächste Bundesregierung (II)
Berliner Denkfabrik konkretisiert Forderungen für die deutsche Außenpolitik: Schaffung einer Art Nationalen Sicherheitsrats, radikaler Kurswechsel gegenüber China, innere Formierung der EU.
BERLIN (Eigener Bericht) - Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) legt konkrete Vorschläge zur Formierung Deutschlands und der EU für die bevorstehenden globalen Machtkämpfe vor. Die Vorschläge, die eine von der DGAP koordinierte Expertengruppe erarbeitet hat, richten sich an die nächste Bundesregierung, die unmittelbar mit ihrer Umsetzung beginnen soll. Die Expertengruppe greift Forderungen auf, die seit geraumer Zeit immer wieder vorgebracht werden, darunter die Einrichtung einer Art Nationalen Sicherheitsrats und der Aufbau einer EU-Interventionstruppe ("European Joint Force"). Besondere Aufmerksamkeit gilt den digitalen Technologien, die etwa als "entscheidender Faktor" für wirtschaftliche Stärke eingestuft werden. Einen radikalen Wandel verlangt das DGAP-Strategiepapier für die Chinapolitik. Eine bedeutende Rolle nehmen Pläne für eine umfassende propagandistische Formierung der Zivilgesellschaft ein. So soll etwa eine "Rating-Agentur" geschaffen werden, die eine "Bewertung" von Medien auf angebliche "Faktentreue der Berichterstattung" vornimmt. ex.klusiv
Die Pandemie als Chance (II)
Amnesty International kritisiert westliche Impfstoffhersteller, weil sie vor allem reiche Länder beliefern. BioNTech vermeldet erneut Rekordgewinn und wird zum Wachstumstreiber.
BERLIN/MAINZ (Eigener Bericht) - Scharfe Kritik an den westlichen Herstellern von Covid-19-Impfstoffen, insbesondere an dem deutschen Unternehmen BioNTech, übt Amnesty International. Wie die Menschenrechtsorganisation in einer heute erscheinenden Studie konstatiert, liegt die Verantwortung dafür, dass bisher nur 0,3 Prozent der weltweit verabreichten Covid-19-Impfdosen armen Ländern zugute kamen, nicht bloß bei den wohlhabenden Staaten des Westens, die die Märkte leerkaufen, um Kinder zu impfen sowie Vakzine zu horten. Schuld daran tragen darüber hinaus die großen Impfstoffproduzenten: Sie verweigern die zumindest zeitweilige Freigabe ihrer Patente und vernachlässigen dramatisch notwendige Lieferungen an die internationale COVAX-Initiative - um zum Teil riesige Gewinne zu erzielen. BioNTech etwa gelang es, seinen Profit im zweiten Quartal 2021 auf 3,92 Milliarden Euro zu steigern - bei einem Gesamtumsatz von 7,36 Milliarden Euro. Das könne die Wende für die zuletzt schwächelnde deutsche Pharmabranche bringen und das deutsche Wachstum beschleunigen, urteilen Experten. Die Versorgung ärmerer Länder leistet derzeit vor allem China. ex.klusiv
Die Indo-Pazifik-Strategie der EU
Brüssel dringt auf stärkere militärische Präsenz der EU im Indischen und im Pazifischen Ozean. Gleichzeitig forcieren Washington und London die Aufrüstung Australiens gegen China.
BERLIN/BRÜSSEL (Eigener Bericht) - Die EU-Kommission präsentiert eine neue Indo-Pazifik-Strategie und dringt auf eine umfassendere militärische Präsenz der EU-Staaten im Indischen und im Pazifischen Ozean. Die Union müsse nicht nur ihre ökonomischen Beziehungen in die Region ausbauen - insbesondere zu Staaten, die sich gegen China positionieren -, sondern auch häufiger Hafenbesuche sowie gemeinsame Übungen mit Anrainerstaaten durchführen, heißt es in dem Papier, das gestern in Brüssel vorgestellt wurde. Zudem gelte es "Maritime Interessengebiete im Indo-Pazifik" zu definieren, in denen man besonders eng mit den Anrainern kooperiere, dies auch militärisch. Die Fregatte Bayern führt ihre aktuelle Asien-Pazifik-Fahrt bereits in diesem Sinne durch. Sie wird in Kürze in Australien eintreffen, das gerade einen neuen Pakt mit den USA und Großbritannien gegen China geschlossen hat. Der AUKUS-Pakt sichert Berlins militärischem Kooperationspartner Australien Atom-U-Boote für Operationen gegen China. Er spitzt zugleich innerwestliche Konflikte zu: Canberra bricht für ihn einen 56 Milliarden Euro schweren Beschaffungsvertrag mit Paris. ex.klusiv
Zum Feind erklärt
Debatte um Ostasienfahrt der Fregatte Bayern hält an. Beijing akzeptiert Berliner Beschwichtigungsversuche nicht. Einflussreiche Tageszeitung erklärt China zum Feind.
BERLIN/BEIJING (Eigener Bericht) - Anhaltende Debatten begleiten die Entsendung der Fregatte Bayern nach Ostasien und ins Südchinesische Meer. Bereits seit Monaten üben außenpolitische Hardliner massive Kritik daran, dass die Fregatte bislang keine speziellen Provokationen gegen die Volksrepublik zusätzlich zur Durchquerung des Südchinesischen Meeres plant; gefordert wurden immer wieder das Eindringen in die Hoheitsgewässer von China beanspruchter Inseln oder das Abhalten gemeinsamer Manöver mit verbündeten Streitkräften. Dass eine direkte "Konfrontation offensichtlich vermieden" werde, gehe den "Verbündeten" Berlins "nicht weit genug", moniert eine Mitarbeiterin des Mercator Institute for China Studies (MERICS). Beijing fordert unterdessen im Hinblick auf den von Deutschland zur Beschwichtigung erbetenen Hafenbesuch der Fregatte in Shanghai, die Bundesregierung müsse sich entscheiden, ob sie die Kooperation oder einen heftigen Konflikt mit Beijing anstrebe. Während die Spannungen eskalieren, geht ein einflussreicher deutscher Leitkommentator über NATO-Sprachregelungen hinaus und erklärt China zum "Feind". ex.klusiv
Die Ängste des "Exportweltmeisters"
Deutsche Ökonomen warnen, der vor allem in den USA und China erstarkende Protektionismus gefährde die exportfixierte deutsche Wirtschaft.
BERLIN/WASHINGTON/BEIJING (Eigener Bericht) - Deutsche Ökonomen und Wirtschaftsmedien fürchten zunehmend um das exportfixierte Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik. Ursache ist der global erstarkende Protektionismus, der vor allem die in eskalierender Rivalität befindlichen Weltmächte USA und China erfasst: Während die Vereinigten Staaten auswärtige Exporteure mit immer schärferen "Buy American"-Vorschriften abwehren, setzt auch die Volksrepublik, zunehmend durch US-Embargos unter Druck, gezielt auf die Verlagerung der Produktionsketten ins eigene Land. Beides gilt als eine ernste Gefahr für die deutsche Exportindustrie. Diese ist, wie jüngst Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bestätigten, stärker von Exporten abhängig als alle anderen westlichen Industrienationen und deshalb von protektionistischen Tendenzen auch mehr als alle anderen bedroht. Das IW warnt zugleich vor einer "De-Globalisierung" auch dahingehend, dass Wertschöpfungsketten weniger als zuvor internationalisiert werden. Als Gegenmaßnahmen sind unter anderem protektionistische Schritte der EU im Gespräch. ex.klusiv
Manöver in Ostasien (II)
Die Fregatte Bayern bricht am Montag nach Ostasien auf. Dort weiten die westlichen Mächte ihre Kriegsübungen rasant aus. US-Militärs warnen vor baldigem Krieg.
BERLIN/BEIJING (Eigener Bericht) - Mit der Entsendung der Fregatte Bayern nach Ostasien am kommenden Montag beteiligt sich die Bundesrepublik an einer rasanten Ausweitung westlicher Kriegsübungen im direkten Umfeld Chinas. Während die Fregatte Bayern im Herbst Operationen zur Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea durchführen sowie anschließend die Heimfahrt durch das Südchinesische Meer antreten wird, ist eine Flugzeugträgerkampfgruppe um den neuen britischen Flugzeugträger HMS Elizabeth schon gestern nach gemeinsamen Übungen etwa mit Kriegsschiffen aus Indien und Singapur in das Südchinesische Meer eingefahren. Die französischen Streitkräfte haben - nach Marinemanövern im Golf von Bengalen Anfang April - in diesem Monat gemeinsame Luftkampfübungen mit US-Jets in Hawaii abgehalten; dazu hatten sie eigens mehrere Rafale-Kampfflugzeuge in das Überseegebiet Französisch-Polynesien mitten im Südpazifik verlegt. Die US-Luftwaffe wiederum hält aktuell ein Manöver ab, das Experten als realistische Probe für einen Krieg gegen China unter heutigen Voraussetzungen einstufen. Hochrangige US-Militärs halten einen baldigen Krieg für denkbar. ex.klusiv
Rezension: "Ami go home!"
Stefan Baron (Ex-Chefredakteur der WirtschaftsWoche) analysiert den Hegemonialkampf der USA gegen China.
"Ami go home"? Das ist nicht der Titel, den man auf einem Buch eines Autors wie Stefan Baron erwartet hätte. Baron, studierter Ökonom, im Laufe seiner beruflichen Karriere unter anderem als Finanzkorrespondent des "Spiegel", Chefredakteur der "WirtschaftsWoche" und zuletzt noch als globaler Kommunikationschef der Deutschen Bank tätig, will seine Schrift denn auch auf gar keinen Fall als "antiamerikanisch" verstanden wissen. Der Publizist, der über Jahre dem Board of Trustees des American Institute for Contemporary German Studies angehörte und bis heute über gute Beziehungen in die Vereinigten Staaten verfügt, befasst sich in seinem Werk mit den großen, historischen Verschiebungen in den globalen Kräfteverhältnissen, die die Gegenwart prägen, mit dem Aufstieg Chinas und dem Bemühen der USA, die Volksrepublik niederzuhalten, um ihre globale Dominanz zu wahren. Konsequenz ist eine gefährliche Zuspitzung des Konflikts, dessen Übergang in einen Dritten Weltkrieg, wie Baron konstatiert, dringendst verhindert werden muss. Das Anliegen treibt ihn zu scharfer Kritik am gegenwärtigen Zustand der Vereinigten Staaten und zu Vorschlägen, wie die Eskalation des transpazifischen Machtkampfs zu verhindern sei. ex.klusiv
Zwischen den Fronten des Kalten Kriegs
Washington weitet vor Besuch der Bundeskanzlerin seine Chinasanktionen aus. Beijing startet Gegenmaßnahmen. Deutsche Firmen sehen ihr Chinageschäft bedroht.
BERLIN/WASHINGTON/BEIJING (Eigener Bericht) - Eine drohende weitere Eskalation im US-Sanktionskrieg gegen China überschattet den morgigen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington. Die Biden-Administration hat vor einigen Tagen neue Zwangsmaßnahmen gegen chinesische Unternehmen in Kraft gesetzt und zieht nun weitere Sanktionen mit Bezug auf Hongkong in Betracht. Beijing droht mit Gegenmaßnahmen. Deutsche Wirtschaftskreise sind alarmiert. Schon die extraterritorial wirksamen US-Sanktionen schaden ihrem Chinageschäft zum Teil erheblich. Im März hat die Volksrepublik Gegensanktionen verhängt, die in manchen Fällen drastische Wirkungen hatten; ihretwegen hat eine einflussreiche Londoner Anwaltskanzlei ihre Außenstelle in Singapur verloren. Darüber hinaus müssen deutsche Unternehmen befürchten, im Fall einer weiteren Eskalation des Sanktionskriegs von Beijings neuem Antisanktionsgesetz getroffen zu werden, das es, einer EU-Verordnung nachempfunden, in China tätigen Firmen strikt untersagt, den Sanktionen von Drittstaaten, etwa der USA, Folge zu leisten. Zu den Themen, die Merkel morgen in Washington besprechen wird, zählt die Chinapolitik. ex.klusiv
Der große Krieg
US-Militärs debattieren über einen Krieg der Vereinigten Staaten gegen China. Der könnte "vielleicht schon 2026 oder 2024" beginnen.
BERLIN/WASHINGTON/BEIJING (Eigener Bericht) - Vor dem Beginn der Asien-Pazifik-Fahrt der deutschen Fregatte Bayern schwillt unter hochrangigen US-Militärs die Debatte über Form und Zeitpunkt eines möglichen großen Krieges gegen China an. Admiral a.D. James G. Stavridis, Ex-NATO-Oberbefehlshaber und Autor eines aktuellen Romans über einen solchen Krieg, hielt bis vor kurzem den Beginn von Kämpfen im kommenden Jahrzehnt für denkbar. Als mögliche Auslöser gelten die Auseinandersetzungen um Taiwan oder um Inseln im Süd- und im Ostchinesischen Meer. Allerdings verschiebt sich Stavridis zufolge das militärische Kräfteverhältnis zwischen den USA und China rasant, und zwar zugunsten der Volksrepublik, die in Teilbereichen - etwa bei der Anzahl ihrer Kriegsschiffe oder in der Cyberkriegführung - bereits aufgeholt habe. Stavridis warnt mittlerweile, "die Schlacht" zwischen Washington und Beijing könne "viel früher kommen". Dabei spielten US-Verbündete eine zentrale Rolle; die USA bänden sie gezielt in immer "aggressivere" Operationen etwa im Südchinesischen Meer ein. Zu den erwähnten Verbündeten gehört auch Deutschland. ex.klusiv
Rezension: "2034"
Ein Roman über den nächsten Weltkrieg.
In den Vereinigten Staaten hat er fast aus dem Stand den Sprung auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft: der Roman "2034", den der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber James Stavridis und der Afghanistan-Veteran Elliot Ackerman in diesem Frühjahr veröffentlicht haben. Das Thema: nichts Geringeres als "der nächste Weltkrieg", wie es im Untertitel heißt - ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China, der mit einer Konfrontation im Südchinesischen Meer anfängt und sich rasch zum massenmörderischen globalen Gemetzel ausweitet. "2034" - gemeint ist das Jahr, in dem dieser Krieg beginnen könnte - soll mittlerweile allein in den USA in mehr als 100.000 Exemplaren verkauft worden sein: Offenbar wird in wachsendem Maß realisiert, dass der fern scheinende Fluchtpunkt, auf den die kontinuierliche Politik der immer schärferen Konfrontation der westlichen Mächte gegenüber China hinausläuft, durchaus blutige Realität werden kann, und das vielleicht sogar schon bald. ex.klusiv
GERMAN-FOREIGN-POLICY.com
Informationen zur deutschen Außenpolitik: Nachrichten + Interviews + Analysen + Hintergründe