Vom Kosovo nach Litauen
Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz im Kosovo erneut verlängert. Der Jugoslawienkrieg 1999 war ein Meilenstein in der Remilitarisierung der deutschen Machtpolitik. Die deutsche Armee ist seitdem nach Osteuropa zurückgekehrt.
BERLIN/PRISTINA (Eigener Bericht) – Deutschland wird seine militärische Präsenz im Kosovo um ein weiteres Jahr fortsetzen. Das hat der Bundestag am gestrigen Donnerstag beschlossen. Die Bundeswehr ist mittlerweile seit 26 Jahren im Kosovo stationiert – mit dem erklärten Ziel, die Region zu stabilisieren. In den vergangenen Jahren ist die Lage allerdings wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen eskaliert. Die Abspaltung des Kosovo von Serbien, die die NATO unter deutscher Beteiligung seit dem Jugoslawienkrieg 1999 forcierte, wird bis heute nur von weniger als der Hälfte der UN-Mitgliedstaaten anerkannt. Dabei ist die Bundesrepublik heute nicht nur Besatzungsmacht im Kosovo, sondern sie hat ihren militärischen Einfluss in Osteuropa im geostrategischen Machtkampf gegen Russland kontinuierlich ausgebaut; die deutsche Beteiligung am völkerrechtswidrigen Überfall auf Jugoslawien 1999 war ein entscheidender Schritt auf dem Weg der deutschen Streitkräfte zurück nach Osteuropa und zur Remilitarisierung der deutschen Machtpolitik. Mittlerweile baut Berlin in Litauen – in einem Gebiet, in dem Deutschland einst seinen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion führte – seinen ersten festen Militärstützpunkt im Ausland auf.
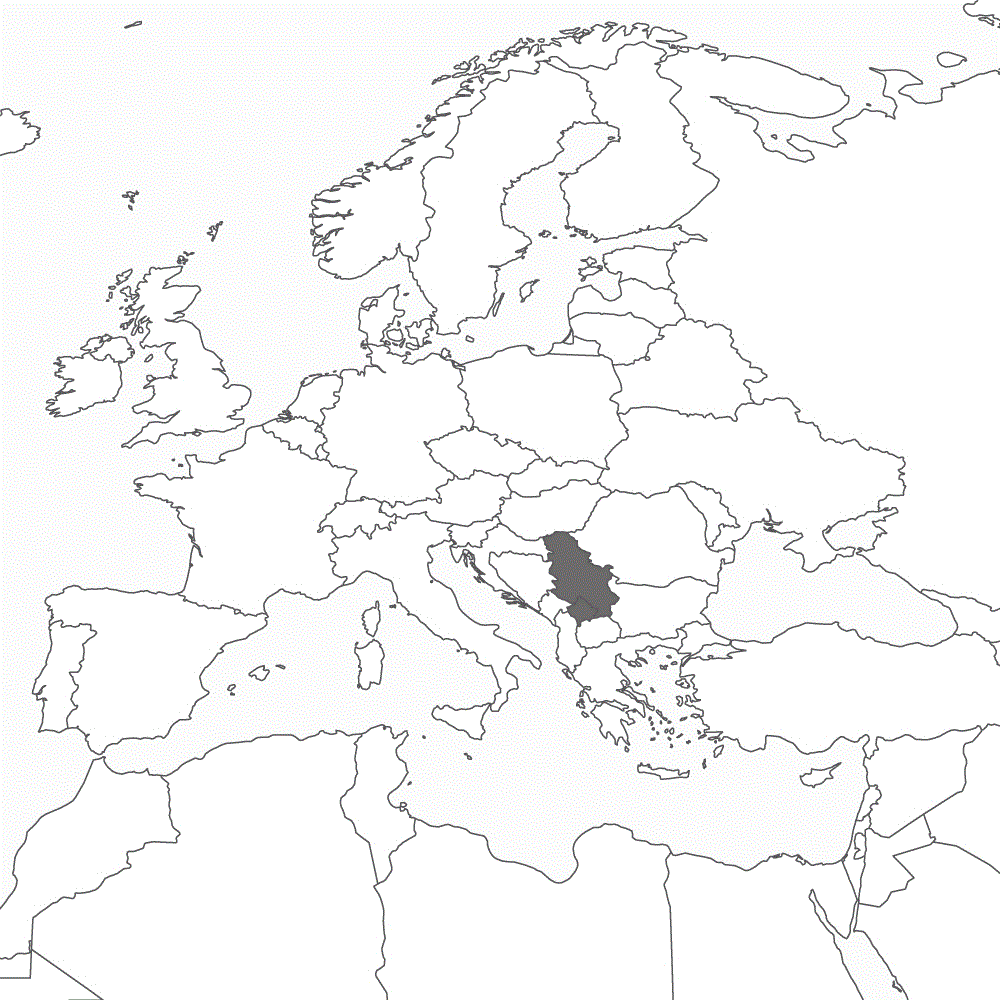
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)