Konflikt um das Chinageschäft
Die Auseinandersetzungen um die Wirtschaftsbeziehungen zu China spitzen sich in Berlin und in Brüssel zu. Washington dringt auf Decoupling; einflussreiche deutsche Unternehmen, darunter Großkonzerne, fordern engere Kooperation.
BERLIN/BRÜSSEL/BEIJING (Eigener Bericht) – In Berlin und in Brüssel spitzen sich die Auseinandersetzungen um die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu China zu. Hintergrund ist das Angebot der Trump-Administration, Ländern günstigere Zölle für Ausfuhren in die USA zu gewähren, wenn sie die ökonomische Kooperation mit China reduzieren. Washington lockt deutsche Kfz-Konzerne zudem mit einer exklusiven Zusammenarbeit bei der Entwicklung des autonomen Fahrens – und zwar mit dem Ziel, gemeinsam chinesische Kfz-Unternehmen zurückzudrängen. Dabei haben deutsche Autohersteller längst begonnen, ihrerseits eng mit chinesischen Unternehmen zu kooperieren; BMW etwa hat vergangene Woche mitgeteilt, neue Modelle nicht nur gemeinsam mit Huawei und Alibaba, sondern auch mit Unterstützung durch das KI-Startup DeepSeek zu entwickeln. Rund drei Dutzend deutsche Unternehmen haben sich mit einem Schreiben an die künftige Bundesregierung gewandt, in dem sie äußern, sie seien zunehmend auf Firmen aus China angewiesen, die immer öfter „Innovationsführer“ seien; sie wünschten daher eine engere Kooperation mit China. Die EU bereitet einen EU-China-Gipfel in der zweiten Julihälfte in Beijing vor.
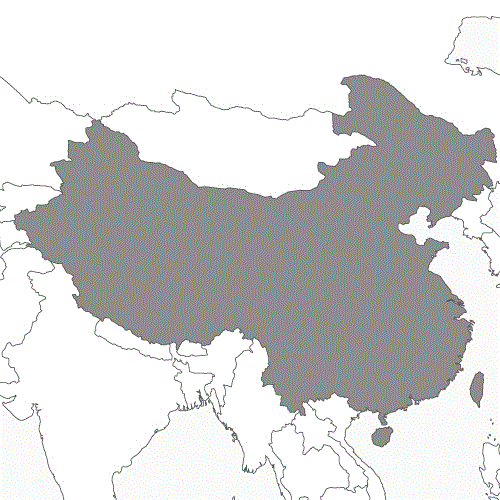
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)