Die Ära der Zollschlachten
EU verhängt erste Vergeltungszölle auf Importe aus den USA, ist aber in der Zollschlacht wegen ihres Handelsüberschusses im Nachteil. US-Wirtschaft fürchtet gleichfalls Einbußen. Trumps Vorgehen löst globale Boykottkampagne aus.
WASHINGTON/BRÜSSEL (Eigener Bericht) – Die EU verhängt erste Vergeltungszölle auf Importe aus den Vereinigten Staaten und bereitet weitere vor. Damit reagiert Brüssel auf die US-Zölle in Höhe von 25 Prozent, die am Mittwoch in Kraft getreten sind und auf Stahl- sowie Aluminiumlieferungen im Wert von ungefähr 26 Milliarden Euro aus der EU erhoben werden. Trump stellt weitere Zölle in Aussicht; die Zollschlacht droht zu eskalieren. Dabei befinden sich die EU und Deutschland im Nachteil: Da sie erheblich mehr Güter in die USA liefern als andersherum, erleiden sie durch allgemeine Zölle größere Schäden. Als Option gilt, Vergeltung auf dem Dienstleistungssektor zu üben, wo die Vereinigten Staaten ein Plus im Handel mit der EU erzielen. Brüssel könnte etwa gegen Tech-Konzerne Trump-naher US-Oligarchen wie Amazon oder X vorgehen. Unterdessen schwillt in der US-Wirtschaft die Unruhe über die Zollpolitik der Trump-Administration an, die die Preise in den Vereinigten Staaten in die Höhe zu treiben beginnt. Laut Berichten nehmen Beschwerden von Managern und Unternehmern im Weißen Haus rasant zu. Zudem startet, ausgehend von Kanada, das Trump den USA einverleiben will, eine globale Boykottkampagne gegen US-Waren.
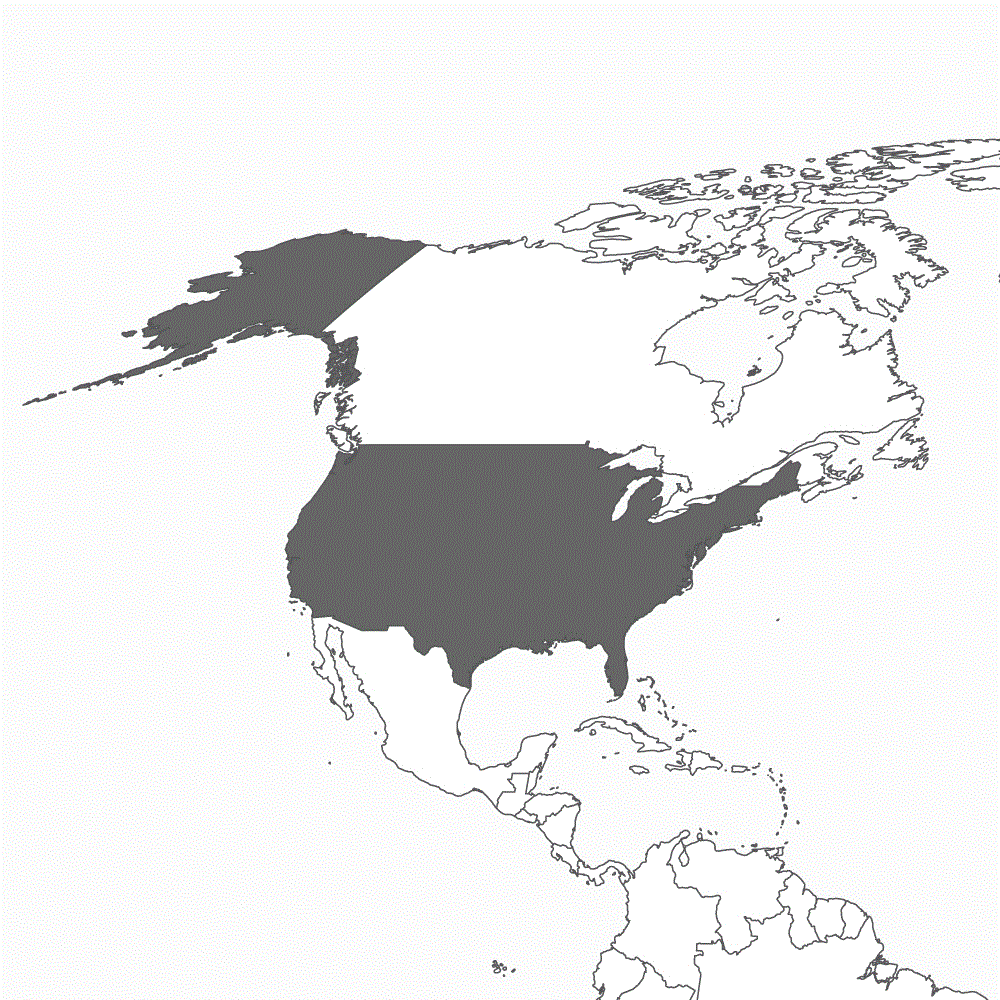
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)