Rezension: Gewerkschaften in der Zeitenwende
Ulrike Eifler beleuchtet in einem Sammelband die Lage der Gewerkschaften inmitten der aktuellen Militarisierung, deren Folgen für Arbeitswelt und Sozialstaat und die Möglichkeiten für den Widerstand dagegen.
„Kriegsvorbereitungen und vor allem der Krieg selbst gehen stets mit enormen Angriffen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden Klassen einher“: Das ist, schreibt Ulrike Eifler in dem von ihr herausgegebenen, soeben erschienenen Sammelband „Gewerkschaften in der Zeitenwende“, eine der Lehren, die man aus der Geschichte ziehen kann. Das gilt zum einen, weil auf den Schlachtfeldern der Vergangenheit „nie Verteidigungsminister, Militärexperten, Militärhistoriker oder Rüstungsfabrikanten gekämpft“ haben, immer aber „der Mann der Arbeit“, wie Eifler konstatiert. Es gilt zum anderen, weil Kriege stets den Abbau von Arbeitsrechten, von Löhnen und von existenziellen Sicherheiten mit sich bringen – „insbesondere für diejenigen, die am meisten darauf angewiesen sind“. Gewerkschaften, betont Eifler, selbst Gewerkschafterin in Würzbürg, haben schon aus diesen Gründen ein „hervorgehobenes Interesse an einer friedlichen Welt“. Vor diesem Hintergrund fragt sie in ihrem facettenreichen Sammelband zunächst nach „den Auswirkungen der aktuellen Kriegsvorbereitungspolitik auf die Welt der Arbeit“.
Und die sind, das ist schon jetzt klar erkennbar, dramatisch. Die Hoffnungen, der „neue Rüstungskeynesianismus“ könne zu einem neuen Aufschwung führen, sind wohl überhöht, auch wenn die Bundesregierung schon dieses Jahr 86 Milliarden Euro ins Militär steckt, „2,5-mal mehr“, als sie „für Bildung und Gesundheit ausgibt“, wie Dierk Hirschel, Gewerkschaftssekretär bei ver.di, feststellt. „Militärausgaben sind keine Investitionen, die später Erträge abwerfen“, schreibt Hirschel; sie sind, rein ökonomisch gesehen, „staatlicher Konsum“, „totes Kapital“. Zudem ziehen sie Ressourcen „aus produktiven Bereichen ab“, was sich negativ auf die Ökonomie auswirkt. Sie werden daher allenfalls „eine geringe gesamtwirtschaftliche Rendite“ abwerfen. Dafür droht die beispiellose Konzentration aller staatlichen Ausgaben auf die Streitkräfte nicht bloß das staatliche Defizit und die Schulden in die Höhe zu treiben; zugleich wird „der Sozialstaat in einem Maße demoliert und demontiert, wie wir es bisher nicht erlebt haben“, schreibt Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär aus Berlin. Man müsse mit Verteilungskämpfen rechnen, „gegen die sich die bisherigen in den letzten Jahrzehnten wie ‘Ringelpiez mit Anfassen‘ ausnehmen“.
Auch die gesellschaftlichen Folgen sind gravierend. So wird etwa das Gesundheitssystem zunehmend auf den Bedarf der Bundeswehr in einem möglichen Krieg ausgerichtet, wie es in einem Beitrag mehrerer Vorstandsmitglieder des Vereins demokratischer Ärtzt*innen (vdää) heißt. Beispiele? Krankenhäuser werden dort geplant, wo sie militärlogistisch gut erreichbar sind, und nicht dort, wo die zivile Bevölkerung sie braucht. Die Weiterbildung medizinischen Personals soll sich zunehmend „an militärischen Bedarfen“ orientieren. Die Bundeswehr wiederum treibt die Militarisierung der gesamten deutschen Gesellschaft mit geballter Energie voran, indem sie bei ihren Rekrutierungsbemühungen nicht nur Jugendliche, sondern sogar Kinder ins Visier nimmt. In einem kleinen Ort im bayerischen Teil Schwabens konnten Sechs- bis Zwölfjährige in den Sommerferien an einer zweitägigen „Bundeswehr-Freizeit“ teilnehmen, zu der Soldaten aus dem NATO-Kommando in Ulm in die örtliche Grundschule anreisten, wie Mark Ellmann von der GEW Bayern berichtet. In Bayern zeitigt übrigens ein neues Schulgesetz Folgen, das vorsieht, dass Schulen mit Jugendoffizieren kooperieren. Inzwischen kommen ungefähr ein Viertel aller minderjährigen Rekruten, die die Bundeswehr anwerben konnte, aus dem Freistaat.
Wer mit der krassen Fokussierung ökonomischer und gesellschaftlicher Ressourcen auf das Militär, mit der beispiellosen Militarisierung der Bundesrepublik nicht einverstanden ist, wird sich zwingend der Frage nach ökonomischen Alternativen stellen müssen – gerade auch nach gangbaren Alternativen für die Rüstungsindustrie. Der Kampf „für höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und bessere Arbeitsbedingungen“ auch in Rüstungsunternehmen, wie ihn die Gewerkschaften führen, müsse also „mit der Diskussion über Rüstungskonversion verbunden werden“, schreibt Anne Rieger, ehemalige Bevollmächtigte der IG Metall in Waiblingen; „für die Zukunft unserer Kinder“ sei es schließlich ein entscheidender Unterschied, „ob Stahl für den Bau von Schulen oder für Panzer hergestellt wird“. Gelder, die „in der Rüstungsindustrie verbrannt“ werden, müssten in den „sozial-ökologische[n] Umbau von Produktion und Gesellschaft“ investiert werden, in eine Produktion also, „mittels der die Vernichtung unserer natürlichen Lebensgrundlage gestoppt und entstandene Schäden repariert“ würden. Dies böte „genügend interessante und gut bezahlte Arbeitsplätze“, hält Rieger fest.
Wie setzt man das durch? Die Probleme liegen tief – historisch tief. Auf globaler Ebene sei eine historische Kräfteverschiebung in der Staatenwelt zu beobachten, in der „der globale Süden an ökonomischer Stärke und politischem Selbstbewusstsein gewinnt“, der „globale Norden“ aber „zunehmend gegen Deindustrialisierung“ und „politischen Bedeutungsverlust“ ankämpfe, analysiert Eifler. Der Kampf gegen den Schwund der altgewohnten Dominanz auf Weltebene löse – gerade auch in Europa – eine „Hochrüstungsdynamik“ aus, die „nur durch erhebliche Sozialkürzungen sichergestellt werden“ könne und zugleich „das Vertrauen der Menschen in die Funktionsfähigkeit der repräsentativen Demokratie weiter erschüttert“. Die Funktionseliten nicht zuletzt in Deutschland zögen den Krieg „als Ausweg aus der wirtschaftlichen Krisenspirale“ und als letztes Mittel im „Kampf um die Weltmacht ernsthaft in Erwägung“, urteilt Eifler. Das Gegenmittel? „Der Aufbau einer gewerkschaftlich verankerten Friedensbewegung als einzigem Bollwerk gegen die organisierte Fahrlässigkeit des herrschenden Blocks bleibt ohne Alternative.“
Ulrike Eifler (Hg.): Gewerkschaften in der Zeitenwende. Was tun gegen Umverteilung nach oben, massive Angriffe auf den Sozialstaat, die Militarisierung des Alltags und den Rüstungswahnsinn? VSA: Verlag. Hamburg, 2025. 144 Seiten. 12,80 Euro.
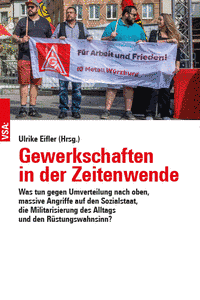
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)