Zurück zu den Iran-Sanktionen (II)
Deutschland, Frankreich und Großbritannien schwächen mit der Wiederinkraftsetzung der Iran-Sanktionen ihren Einfluss auf künftige Iran-Verhandlungen. Teheran setzt auf Geschäfte mit nichtwestlichen Staaten – Russland, China, Türkei.
TEHERAN/BERLIN (Eigener Bericht) – Die erneute Inkraftsetzung der UN-Sanktionen gegen Iran durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien schwächt deren Position im Mittleren Osten und könnte zudem weitgehend scheitern. Dass die europäischen Staaten selbst die Embargomaßnahmen wieder aktiviert hätten, werde keine großen Konsequenzen haben, urteilen Beobachter: Sanktionen der ersten Trump-Administration verhindern schon seit Jahren den Großteil des europäischen Iran-Geschäfts. Russland wiederum hat schon angekündigt, es erkenne den „Snapback“ nicht an, mit dem Berlin, Paris und London den UN-Sanktionen aus der Zeit vor dem Abschluss des Atomabkommens zu neuer Geltung verhelfen wollen. China hat seinerseits laut Berichten ein Bartersystem entwickelt, mit dem milliardenschwere Geschäfte trotz bestehender US-Sanktionen möglich sind. Aus Teheran heißt es allerdings, mit der Auslösung des „Snapbacks“ hätten die drei Staaten Westeuropas „die Rechtfertigung für Verhandlungen mit ihnen fast komplett beseitigt“; sie würden in Gesprächen über die Zukunft Irans von nun an „eine viel kleinere Rolle“ spielen. Demnach ist ihr Versuch, mit dem Snapback Macht zu demonstrieren, ohne sie wirklich zu haben, gescheitert.
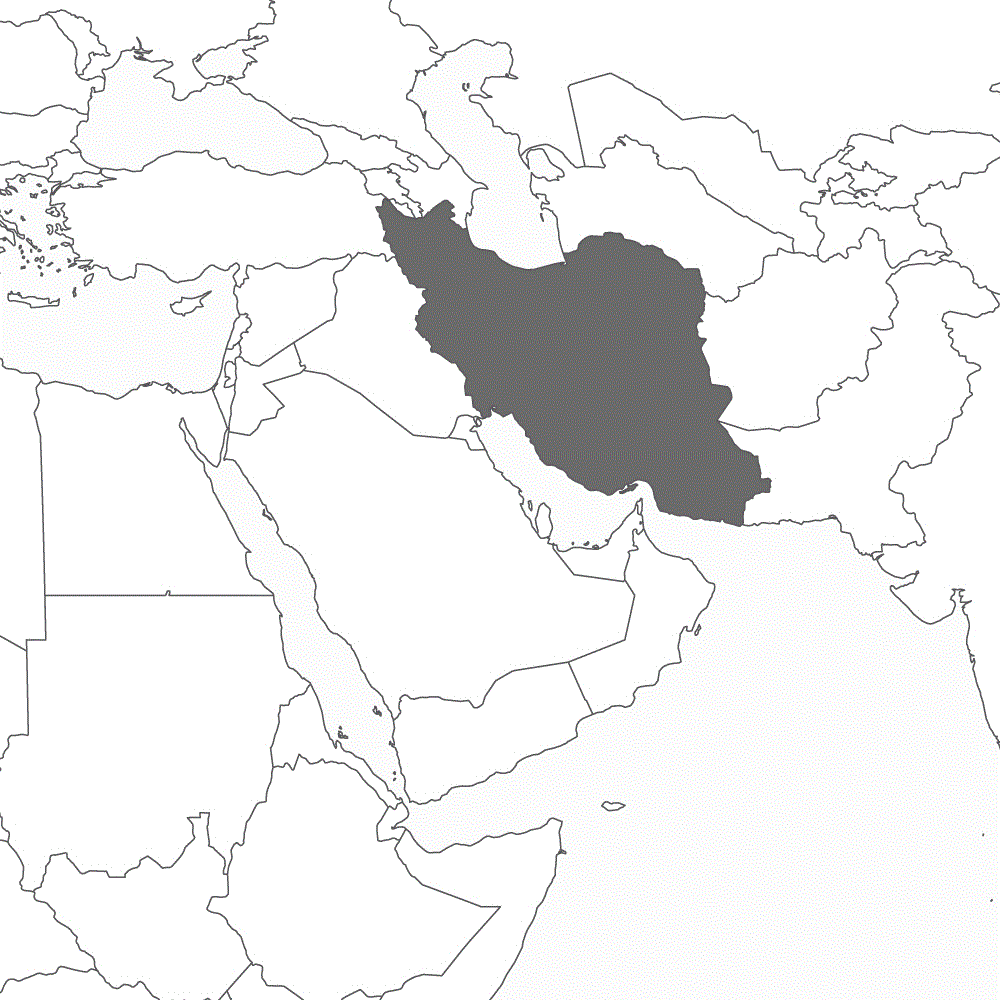
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)