Teil der deutschen Produktionsketten (II)
Sorgen in Berlin vor Amtseinführung des neuen polnischen Präsidenten Nawrocki: Dieser ist für die Partei PiS gewählt worden, die deutschen Interessen weniger Rechnung trägt als die Bürgerplattform von Ministerpräsident Tusk.
WARSCHAU/BERLIN (Eigener Bericht) – Vor der Amtseinführung des neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki werden in Berlin Sorgen über eine mögliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen Deutschland und Polen laut. Nach den Parlamentswahlen im Oktober 2023 war in der Bundesrepublik wie auch in weiten Teilen der EU das Comeback des neoliberalen Pro-EU-Ministerpräsidenten Donald Tusk gefeiert worden. Allerdings kann Tusk wichtige Gesetzesvorhaben nicht durchsetzen und wird auch weiterhin kaum dazu in der Lage sein, da mit Nawrocki auch in Zukunt ein Parteigänger der Kaczyński-Partei PiS das Amt des Präsidenten ausüben wird und gegen ihm missliebige Pläne sein Veto einlegen kann. Die PiS und Tusks Bürgerplattform unterscheiden sich unter anderem in ihren Vorstellungen zur Entwicklung der EU, in ihrer Nähe zu den USA und in ihren regionalen Strategien. So orientiert die Bürgerplattform, deutschen Interessen entsprechend, auf eine immer tiefere EU-Integration, während die PiS einen Machtabbau bei den EU-Institutionen favorisiert. Auch die Regionalpolitik der PiS ist darauf angelegt, Gegengewichte gegen die deutsche Dominanz zu fördern. Von Nawrocki erwarten Beobachter stärkere Opposition zur Bundesrepublik.
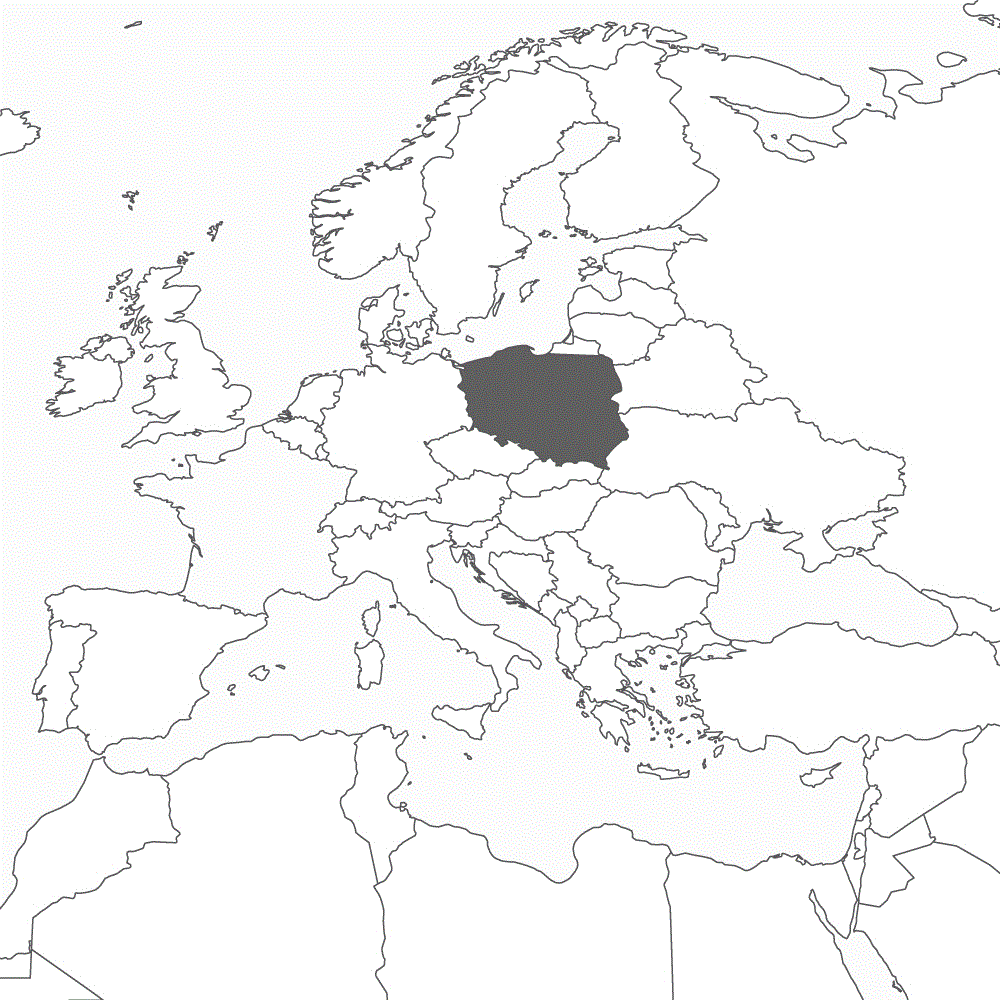
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)