Noch immer kein Take-off
Merz und Macron vertagen Lösung im Streit um den deutsch-französischen Kampfjet der sechsten Generation (FCAS) bis Ende August. Das Projekt ist von ungelösten Differenzen und von britischer Konkurrenz bedroht.
BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) – Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben die Lösung des sich zuspitzenden Streits um den deutsch-französischen Kampfjet FCAS (Future Combat Air System) bis Ende August verschoben. Die Entscheidung fiel bei einem Treffen von Merz und Macron am Mittwochabend angesichts zunehmender Ungewissheit über die Zukunft des Jets der modernsten sechsten Generation, der ab 2040 einsatzbereit sein soll. Das 2017 gestartete Projekt kostet mehr als 100 Milliarden Euro; es zielt darauf ab, Europas Abhängigkeit von den USA bei den modernsten Kampfjets zu beenden und die strategische Autonomie der EU im Rüstungsbereich voranzutreiben. Allerdings war das Vorhaben von Anfang an von Verzögerungen und Kontroversen geprägt, die vor allem auf Streitigkeiten über die Aufteilung von Projektmitteln und technologischen Filetstücken zwischen Deutschland und Frankreich zurückzuführen sind. Gleichzeitig schreitet die von Großbritannien angeführte Entwicklung eines konkurrierenden Kampfjets der sechsten Generation schneller voran; der „Tempest“ soll bereits ab 2035 einsatzbereit sein. Ein Scheitern des FCAS wäre ein schwerer Rückschlag für das Streben der EU nach strategischer Autonomie.
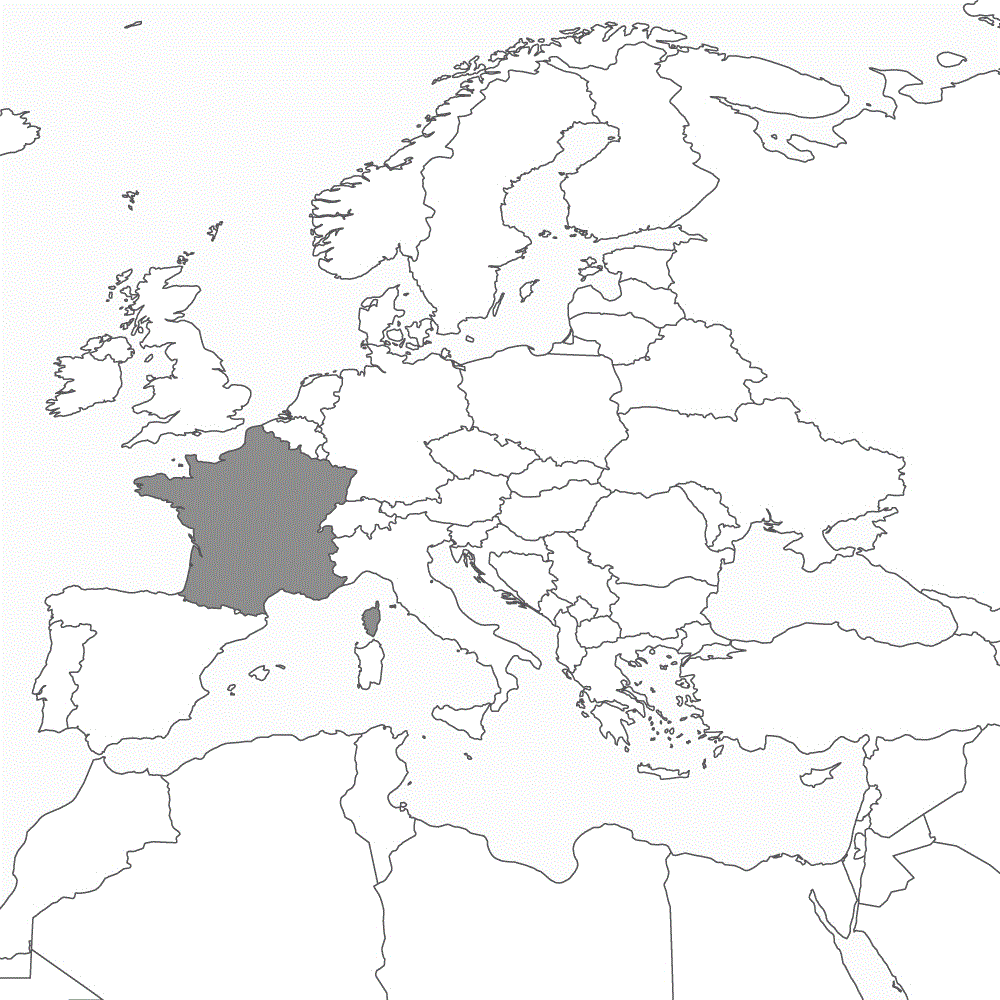
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)