Deep Precision Strike
Bundesregierung bereitet vorläufige Beschaffung US-amerikanischer und langfristige Entwicklung europäischer Marschflugkörper vor. Letztere sollen militärische Unabhängigkeit von den USA sichern.
BERLIN/LONDON (Eigener Bericht) – Die Bundesregierung bereitet die vorläufige Beschaffung weitreichender US-Marschflugkörper und die langfristige Entwicklung von den USA unabhängiger europäischer Marschflugkörper vor. Wie Verteidigungsminister Boris Pistorius in der vergangenen Woche bestätigte, ist Deutschland an einem Erwerb der mobilen Abschussplattform Typhon interessiert. Damit lassen sich Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von gut 2.000 Kilometern abfeuern. Typhon und Tomahawk werden von US-Konzernen hergestellt und sind bereits erhältlich. Zugleich treiben Berlin und London die Entwicklung eigener weitreichender Waffen (Deep Precision Strike, DPS) voran. Sie könnten in sieben bis zehn Jahren zur Verfügung stehen und als zentraler Baustein des European Long-Range Strike Approach (ELSA) dienen, eines Projekts, das von heute sieben EU-Staaten getragen wird und die europäischen Staaten bei Marschflugkörpern oder auch ballistischen Raketen von den USA unabhängig machen soll. Mit Blick auf ELSA haben auch französische Rüstungskonzerne erste Vorschläge für weitreichende Waffen vorgelegt. Damit zeichnet sich erneut harte innereuropäische Konkurrenz in der Rüstungsindustrie ab.
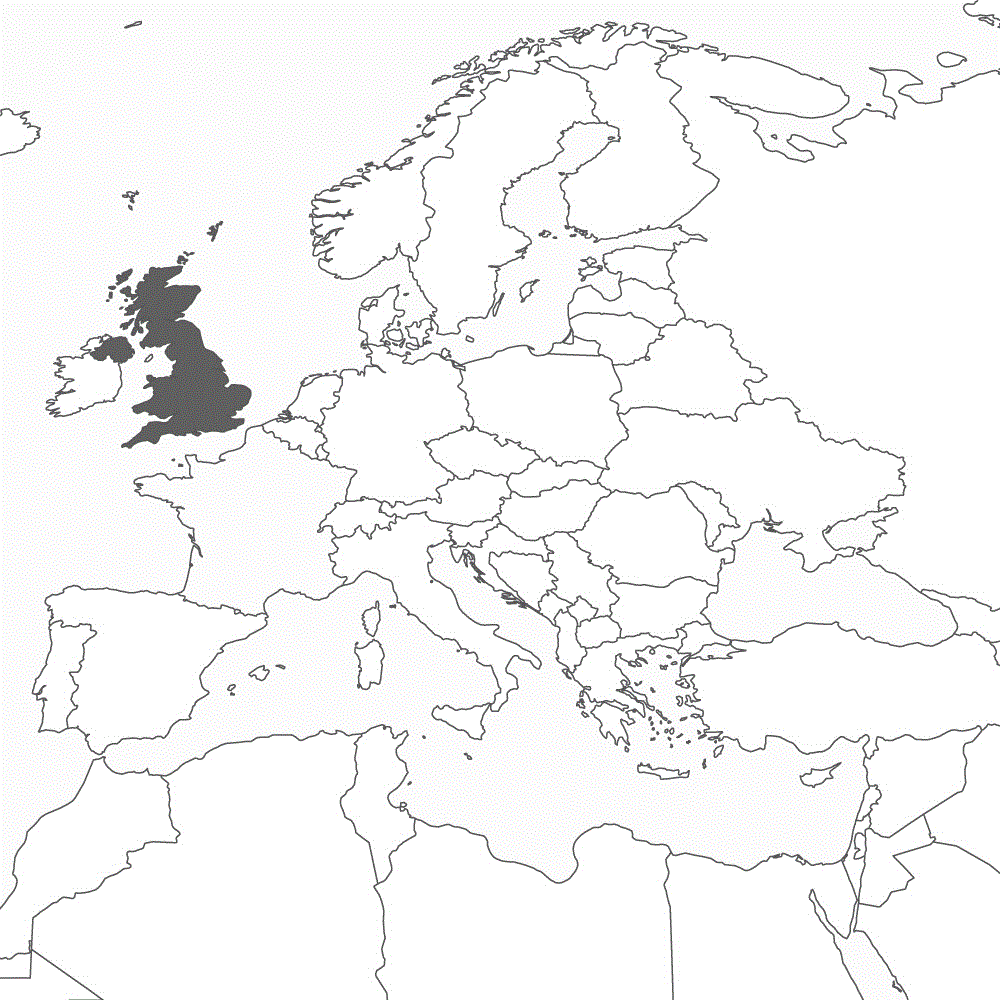
ex.klusiv
Den Volltext zu diesem Informationsangebot finden Sie auf unseren ex.klusiv-Seiten - für unsere Förderer kostenlos.
Auf den ex.klusiv-Seiten von german-foreign-policy.com befinden sich unser Archiv und sämtliche Texte, die älter als 14 Tage sind. Das Archiv enthält rund 5.000 Artikel sowie Hintergrundberichte, Dokumente, Rezensionen und Interviews. Wir würden uns freuen, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können - für 7 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Dann klicken Sie hier:
Persönliches Förder-Abonnement (ex.klusiv)
Umgehend teilen wir Ihnen ein persönliches Passwort mit, das Ihnen die Nutzung unserer ex.klusiven Seiten garantiert. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Die Redaktion
P.S. Sollten Sie ihre Recherchen auf www.german-foreign-policy.com für eine Organisation oder eine Institution nutzen wollen, finden Sie die entsprechenden Abonnement-Angebote hier:
Förder-Abonnement Institutionen/Organisationen (ex.klusiv)