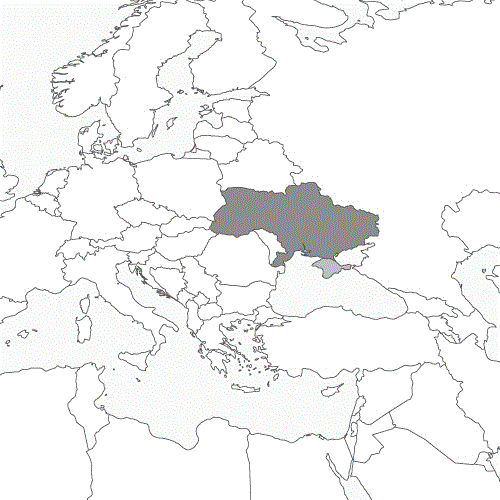Dispute autour du plan à 28 points
Dans le cadre des négociations à Genève, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne cherchent à modifier des éléments centraux du plan en 28 points pour un cessez-le-feu, notamment dans l'intérêt de leur industrie de l’armement.
BERLIN/WASHINGTON (rapport exclusif) L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne cherchent, dans le cadre des négociations avec des Etats-Unis à Genève, à modifier en profondeur les éléments centraux du plan en 28 points pour un cessez-le-feu en Ukraine. Il s'agit d'une part de déterminer à quoi serviront exactement les avoirs russes gelés dans l'UE, et d'autre part de définir les restrictions qui seront imposées aux forces armées ukrainiennes. Alors que Berlin et Bruxelles affirment officiellement défendre les intérêts de l'Ukraine, il s'agit en réalité des intérêts de l'Allemagne et de l'UE. L'UE prévoit ainsi d'utiliser les avoirs russes à l'étranger pour armer l'Ukraine avec des armes issues de sa propre production, ce qui favorise le développement de l'industrie de l'armement de l'UE. Le plan en 28 points prévoit l'utilisation des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine. Il contient en outre des restrictions pour les forces armées ukrainiennes, qui pourraient entrer en conflit avec les projets de plusieurs États membres de l'UE visant à exporter de manière lucrative des armes vers ce pays. Si Berlin et Bruxelles parviennent à imposer leurs exigences, le plan en 28 points risque d'échouer. La guerre se poursuivrait alors.
« Un débat fantôme »
Le plan actuel de cessez-le-feu en Ukraine contrecarre à plusieurs égards les projets centraux de l'Allemagne et des autres grands pays européens membres de l’OTAN. D'une part, début septembre, une « coalition des volontaires » menée par la France et la Grande-Bretagne a annoncé son intention de stationner des troupes sur le territoire ukrainien à long terme afin de garantir le cessez-le-feu (german-foreign-policy.com en a rendu compte [1]). La présence de troupes d'Europe occidentale exercerait à long terme une pression militaire sur la Russie, un élément de la lutte de pouvoir contre Moscou que les grands États d'Europe occidentale sont déterminés à poursuivre. Des experts ayant une certaine distance par rapport à la politique opérationnelle avaient déclaré dès le départ que ce projet rendrait un cessez-le-feu pratiquement impossible. Ainsi, l'ancien diplomate de haut rang et actuel président du conseil d'administration de la Conférence de Munich sur la sécurité, Wolfgang Ischinger, avait estimé que, puisque Moscou ne serait de toute façon pas d'accord avec ce déploiement, il s'agissait simplement d'un « débat fantôme ».[2] Cela se confirme aujourd'hui : le plan en 28 points exclut explicitement la présence de forces étrangères sur le territoire ukrainien.[3]
Les avoirs russes à l'étranger
D'autre part, le plan de cessez-le-feu contrecarre les projets d'armement des États d'Europe occidentale, et ce à plusieurs égards. Ainsi, l'UE souhaite à l'avenir transférer à l'Ukraine non seulement les intérêts, mais aussi une grande partie des avoirs étrangers russes situés en Europe, ce qui est illégal. La Belgique s'y oppose, car elle abrite la majeure partie des avoirs russes et serait donc principalement concernée par les demandes d'indemnisation à venir. Cependant, la pression sur le gouvernement du pays pour qu'il cesse de s'opposer à cette mesure ne cesse de croître. L'UE prévoit de prélever 140 milliards d'euros et de les mettre à la disposition de Kiev, principalement pour couvrir ses dépenses militaires (german-foreign-policy.com en a fait état [4]). Cela permettrait à l'Ukraine d'acheter notamment des armes produites en Europe occidentale. Lundi dernier, à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, le président Volodymyr Zelensky a ainsi déclaré qu'il comptait pouvoir utiliser d'une manière ou d'une autre les avoirs russes pour financer l'achat de 100 avions de combat Rafale, de drones, de systèmes de défense antiaérienne SAMP/T et d'autres équipements militaires coûteux de fabrication française[5].
Reconstruction plutôt que réarmement
Le plan en 28 points ne serait alors plus d'actualité. Celui-ci prévoit que l'Ukraine reçoive 100 milliards de dollars provenant des avoirs russes à l'étranger, avec l'accord explicite de la Russie et donc en toute légalité, mais qu'elle les investisse dans des projets de reconstruction menés par des US. La moitié des bénéfices qui pourraient en résulter doivent être reversés aux États-Unis.[6] L'UE devrait s'engager à fournir 100 milliards de dollars US supplémentaires pour la reconstruction. Elle n'est pas disposée à le faire. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a demandé ce week-end que « le rôle central de l'Union européenne dans la garantie de la paix pour l'Ukraine » soit « pleinement reflété » dans le plan de cessez-le-feu. Selon un journaliste bien informé, cela pourrait être « interprété comme une référence à l'utilisation des avoirs de la Banque centrale russe gelés dans l'UE ».[7]
Restrictions pour l'industrie de l'armement
La fin de la guerre aurait également des conséquences pour l'industrie allemande des drones, qui est en plein essor. Celle-ci n'est pas seulement financée en grande partie par les exportations de drones vers l’Ukraine. Elle profite également du fait qu'elle tire directement profit de l'expérience acquise dans la guerre des drones, en étroite collaboration avec les forces armées ukrainiennes, qu'elle intègre immédiatement cette expérience dans le développement des systèmes d'armes et qu'elle peut ainsi atteindre et conserver une position de leader sur le marché mondial (german-foreign-policy.com a rapporté [8]). On ne sait pas dans quelle mesure elle pourra maintenir sa coopération avec les forces armées ukrainiennes et sa production en Ukraine après la fin éventuelle des combats sur la base du plan en 28 points. Cela dépendra de la formulation des restrictions relatives à l'armement ukrainien, qui sont énoncées en termes généraux dans la version actuelle du plan ; selon ce dernier, les systèmes d'armes de grande portée ne seraient pas autorisés. On ne sait pas non plus si la livraison prévue de 100 avions de combat Rafale est autorisée dans le cadre du plan en 28 points. Pour Dassault, l'un des principaux groupes français d'armement, il s'agit là d'importants profits à l'exportation.
« Inacceptable »
En conséquence, les représentants de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne se sont efforcés dimanche dernier à Genève d'influencer les négociations qui s'y déroulent, principalement entre des Etats-Unis et l’Ukraine. Des Etats-Unis ont dépêché le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff. L'Ukraine est quant à elle représentée par le chef de l'administration présidentielle, Andrij Jermak. Pour l'Allemagne, Günter Sautter, conseiller en politique étrangère et militaire du chancelier Friedrich Merz, participe aux discussions. Aucun détail sur les résultats intermédiaires possibles n'a encore été communiqué. Merz a explicitement qualifié d'« inacceptables » les dispositions du plan en 28 points concernant l'utilisation des avoirs russes à l'étranger, qui se trouvent dans l'UE et ne peuvent donc pas être utilisés par des Etats-Unis, a-t-il expliqué. On ne voit toutefois pas pourquoi l'UE devrait pouvoir en disposer : il s'agit de biens russes. Selon le chancelier fédéral, la demande selon laquelle l'UE devrait verser 100 milliards de US-dollars supplémentaires pour la reconstruction de l'Ukraine est également « inacceptable ».[9]
[1], [2] Voir à ce sujet Des garanties de sécurité risquées.
[3] Barak Ravid, Dave Lawler : Trump’s full 28-point Ukraine-Russia peace plan. axios.com 20/11/2025.
[4] Voir à ce sujet Russisches Staatsvermögen im Visier. [Les biens publics russes dans le collimateur].
[5] Michaela Wiegel : Finanzierung ungeklärt [Financement incertain]. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 novembre 2025.
[6] Barak Ravid, Dave Lawler : Trump’s full 28-point Ukraine-Russia peace plan. axios.com 20/11/2025.
[7] Mit dem Herzchen in der Hand. [Avec un petit cœur dans la main.] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 novembre 2025.
[8] Voir à ce sujet La crise des drones (II) .
[9] „Sehr produktives Treffen“. [« Une rencontre très productive ».] tagesspiegel.de, 23 novembre 2025.