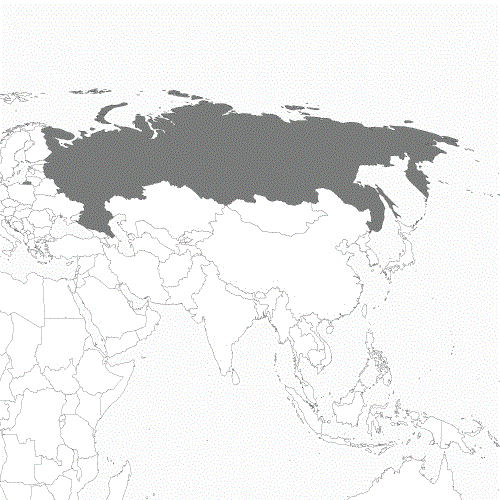Russisches Staatsvermögen im Visier
Berlin lässt eine zunehmende Bereitschaft erkennen, auf russisches Staatsvermögen zuzugreifen, das in der EU angelegt ist. Anlass ist der Wunsch, die Verlängerung des Krieges zu finanzieren, ohne selbst zu zahlen.
BERLIN/MOSKAU (Eigener Bericht) – Berlin signalisiert eine zunehmende Bereitschaft, den Zugriff auf in der EU angelegtes russisches Staatsvermögen freizugeben und daraus die künftige Aufrüstung der Ukraine zu finanzieren. Werden bislang lediglich die Zinserträge aus den wohl rund 260 Milliarden Euro in der EU eingefrorener russischer Gelder abgeschöpft, so könne man in Zukunft die Mittel selbst – im Vorgriff auf mögliche russische Reparationen für die Ukraine – als „Reparationsdarlehen“ nach Kiew überweisen, schlug vergangene Woche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor. Am Wochenende erklärte dazu Günter Sautter, außenpolitischer Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz, die Debatte in der EU bewege sich „in die richtige Richtung“. Eine Vorlage dazu hatte bereits im Frühjahr Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Skizze eines denkbaren Vorgehens geliefert. Bislang hatte Berlin eine Beschlagnahmung russischer Gelder abgelehnt: Sie könnte den Weg für eine Beschlagnahmung deutschen Vermögens als Reparation für NS-Verwüstungen bahnen. Der Zugriff auf russisches Geld soll eineVerlängerung des Ukraine-Kriegs möglich machen, die die Bevölkerung des Landes mehrheitlich ablehnt.