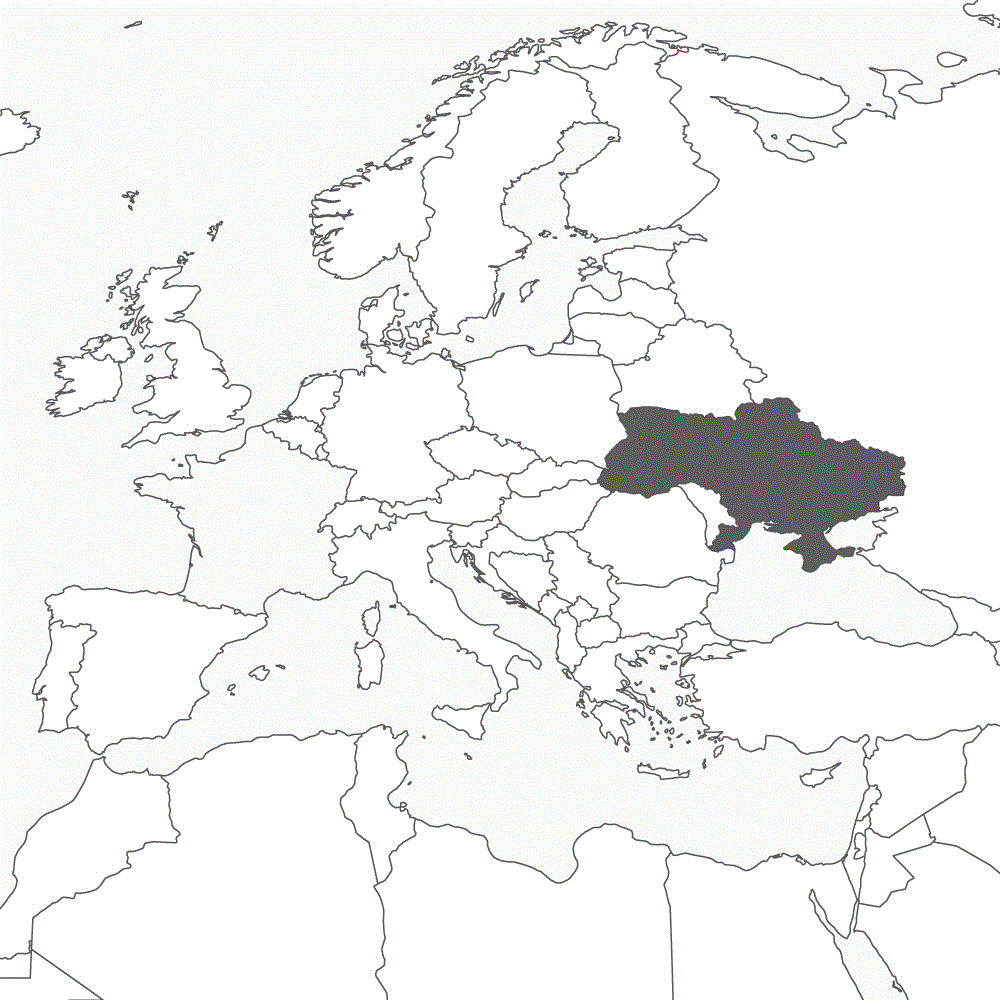Zwischen Moskau und Berlin (IV)
KIEW/WARSCHAU/BERLIN (Eigener Bericht) - Wenige Tage vor Beginn der Fußball-EM führt die Erinnerung an Mordaktionen ukrainischer NS-Kollaborateure zu Verstimmungen zwischen der Ukraine und Polen. Warschauer Regierungspolitiker verlangen, Kiew solle der öffentlichen Ehrung ukrainischer Milizionäre endlich ein Ende setzen, die während des Zweiten Weltkriegs an der Seite der Deutschen für bestialische Morde an Polen verantwortlich waren. Dabei handelt es sich unter anderem um den NS-Kollaborateur Stepan Bandera, einen Anführer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), dessen Milizen beispielsweise am 11. Juli 1943 insgesamt 99 Ortschaften im okkupierten Polen überfielen und dabei zahllose Polinnen und Polen massakrierten. Bandera wird vor allem in der Westukraine, in der die derzeit inhaftierte Ex-Ministerpräsidentin Timoschenko ihr Wahlpublikum hat, mit zahlreichen Denkmälern verehrt. Die OUN, 1929 unter Mitwirkung Berlins gegründet, entwickelte sich im Verlauf der 1930er und 1940er Jahre zur politisch maßgeblichen Organisation des ukrainischen Nationalismus; sie versuchte nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion mehrfach, unter deutscher Oberherrschaft einen ukrainischen Staat zu gründen. Ihre Massaker richteten sich gegen die polnische Bevölkerung und bevorzugt gegen jüdische Opfer. Die NS-Kollaboration zahlreicher Ukrainer ist in der Bundesrepublik zuletzt durch den Prozess gegen den früheren KZ-Wächter John Demjanjuk in Erinnerung gerufen worden.